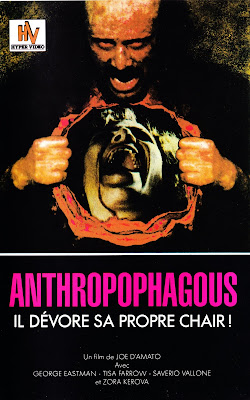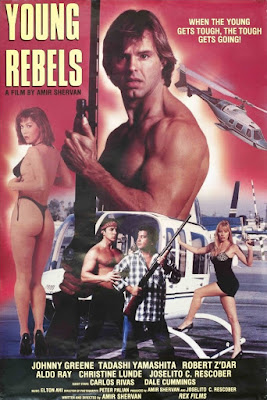Liebr Lesee,
erinnert ihr euch noch an das Intro von
letzter Woche? Tja, im Grunde habe ich die dort erwähnte
Herangehensweise ans Texten nun tatsächlich so weit wie möglich
umgesetzt und jeden Film mit maximal 350 Wörtern an Besprechung
beehrt. Ich möchte aber trotzdem mal meinen, dass euch Lesern da
letzten Endes nicht viel an Lesestoff fehlen wird, denn das Programm
beläuft sich tatsächlich auf 15 ausführlich mit Meinungen
ausgestattete Titel! In dem Fall ist es also unter Umständen noch
ganz angenehm, so kompakt in die Empfehlungen schielen zu können,
auch wenn ich bei längerem Freiraum Richtung WochenENDE sicherlich
noch detaillierteren Stoff hätte liefern können. Zum einen gab es
allerdings diese problematische Umstellung auf die Sommerzeit, zum
anderen war ich bis Samstag Abend noch mit einem Workload am
Schnittpult beschäftigt, der zurecht nicht auf sich warten lassen
konnte. Dennoch hielt sich die Ambition des Wittes binnen der Woche
wacker, denn was sonst wäre so spontan und gemeingefährlich zu
bewerkstelligen wie der Plan, einen 24-Stunden-Marathon von Mittwoch
auf Donnerstag im Eigenheim zu veranstalten? Ganz recht, die
Mammutmenge an Sichtungen, die hier nun per Schreibkraft reflektiert
wird, entstammt jener Herausforderung hinsichtlich Schlafentzug,
Auffassungsgabe und Durchhaltevermögen – und ich kann stolz sein,
zu verkünden, dass es eigentlich recht gut geklappt hat; auch dank
Kaffee, Cola, Fleisch, Pizza und moralischen Support meiner Freunde
und Bewunderer, hihi. Gut, einen Film habe ich mit nur einem Satz
bedacht, aber der Rest sollte nicht ohne seine verdiente Erwähnung
wie Eindrucksschilderung auskommen – so ist es dann auch geschehen!
Ich weiß jedenfalls nicht, ob ich demnächst noch solche
Großprojekte aufziehe, da nach dem Zehnerpack der letzten Ausgabe
auch mal Schluss sein muss, sich so zu verausgaben. Echt mal, ich
habe schon Muskelkater in den allmählichen lahmgewordenen Pfoten,
aber: Selbst Schuld, ne? Von daher möchte ich (mich) nicht länger
aufhalten und auch diesen Text bei unter 350 Wörtern belassen –
ein Hinweis noch: Der erste Film war außerhalb der Aktion auf der
Mattscheibe, danach kommt aber das zentrale Pensum meiner
cineastischen Völlerei zu Wort. Auf auf!

 Wie lassen sich 24 Stunden an Filmen
fröhlicher anfangen, als mit einem Fest der Gigabrüste via Russ
Meyer? Auf Geheiß der „Megavixens“ gilt es also, die
Enthemmung zu fördern, insbesondere im Amerika zu Beginn der 70er
Jahre Freigeistig- oder Feistigkeit zu markieren, wozu sich natürlich
auch die üblen Wurzeln menschlicher Schöpfung anmelden, ehe man die
Ernte an Hasch und Haut einfährt. Im höchsten Maße konfliktgeil
steuert da Sheriff Harry (Charles Napier) der wüsten Wüste
entgegen, mit permanent rotem Schädel und Grinsen auf Korruption
eingestellt, Fremdenhass und Leibesvisitation im satirischen
Wahn des Hardboiled-Kollers zu verknüpfen, während der Geist
der Nation in Gestalt draller Nacktheit (Uschi Digard) an Schrecken
staunt oder die Subversion per Frivolität montiert. Die harten Typen
kriegen indirekt ihr Fett weg, werden vom Groove der Lust wie jeder
andere auch auf die Triebe hin ausgepellt, weshalb das von Harry
umschwärmte Pendel zwischen Cherry (Linda Ashton) und Raquel
(Larissa Ely) nicht ausbleibt, im Endeffekt aber ohne ihn zur
Beglückung auf Augenhöhe gelangen kann. Voraussetzung dafür ist
sein Buckeln vor dem bettlägrigen Mr. Franklin (Frank Bolger), einem
Verbrecherguru mit ebenbürtiger Promiskuität, der die Invasoren
an Mexikanern und Indianern loswerden will, damit der gemeinsame
Schmuggel von Marihuana verhüllt bleibt. Die Vergänglichkeit solch
böswilliger Widersprüche hallt bis heute nach, passend dazu wird
das kriminelle Element Droge von Meyer wie gehabt eher als ironischer
Aufhänger an Moral verwendet, um die Exploitation daran
ballen zu lassen. Da hat sich seit den „Satansweibern
von Tittfield“ nichts geändert, höchstens eine Erhöhung der
Dosis Delirium, inwiefern der Rahmen der Reportage mit seiner
Ära spielt, am Narrativ vorbei frohlockt, Sprachen mischt und anhand
der Frauenflowerpower ohnehin jedes Ei weichkocht. Das
Macho-Kompendium kommt dennoch wie aus der Kanone geschossen, weil
das Leben ohne nur halb so aufregend wäre – mit dem Herzblut bei
der Sache zu sein, heißt auch, dass es herauszuballern geht und da
spart der Film kein Räudentum aus, um manch zynische Schnauze tönen
zu lassen. Doch wenn deren Dödel frei durch die Prärie schwingt und
die Fantasie vom Nippelnuckeln aus dem Sand buddelt, zeugt das
Gegeneinander beinahe schon von utopischer Harmonie.
Wie lassen sich 24 Stunden an Filmen
fröhlicher anfangen, als mit einem Fest der Gigabrüste via Russ
Meyer? Auf Geheiß der „Megavixens“ gilt es also, die
Enthemmung zu fördern, insbesondere im Amerika zu Beginn der 70er
Jahre Freigeistig- oder Feistigkeit zu markieren, wozu sich natürlich
auch die üblen Wurzeln menschlicher Schöpfung anmelden, ehe man die
Ernte an Hasch und Haut einfährt. Im höchsten Maße konfliktgeil
steuert da Sheriff Harry (Charles Napier) der wüsten Wüste
entgegen, mit permanent rotem Schädel und Grinsen auf Korruption
eingestellt, Fremdenhass und Leibesvisitation im satirischen
Wahn des Hardboiled-Kollers zu verknüpfen, während der Geist
der Nation in Gestalt draller Nacktheit (Uschi Digard) an Schrecken
staunt oder die Subversion per Frivolität montiert. Die harten Typen
kriegen indirekt ihr Fett weg, werden vom Groove der Lust wie jeder
andere auch auf die Triebe hin ausgepellt, weshalb das von Harry
umschwärmte Pendel zwischen Cherry (Linda Ashton) und Raquel
(Larissa Ely) nicht ausbleibt, im Endeffekt aber ohne ihn zur
Beglückung auf Augenhöhe gelangen kann. Voraussetzung dafür ist
sein Buckeln vor dem bettlägrigen Mr. Franklin (Frank Bolger), einem
Verbrecherguru mit ebenbürtiger Promiskuität, der die Invasoren
an Mexikanern und Indianern loswerden will, damit der gemeinsame
Schmuggel von Marihuana verhüllt bleibt. Die Vergänglichkeit solch
böswilliger Widersprüche hallt bis heute nach, passend dazu wird
das kriminelle Element Droge von Meyer wie gehabt eher als ironischer
Aufhänger an Moral verwendet, um die Exploitation daran
ballen zu lassen. Da hat sich seit den „Satansweibern
von Tittfield“ nichts geändert, höchstens eine Erhöhung der
Dosis Delirium, inwiefern der Rahmen der Reportage mit seiner
Ära spielt, am Narrativ vorbei frohlockt, Sprachen mischt und anhand
der Frauenflowerpower ohnehin jedes Ei weichkocht. Das
Macho-Kompendium kommt dennoch wie aus der Kanone geschossen, weil
das Leben ohne nur halb so aufregend wäre – mit dem Herzblut bei
der Sache zu sein, heißt auch, dass es herauszuballern geht und da
spart der Film kein Räudentum aus, um manch zynische Schnauze tönen
zu lassen. Doch wenn deren Dödel frei durch die Prärie schwingt und
die Fantasie vom Nippelnuckeln aus dem Sand buddelt, zeugt das
Gegeneinander beinahe schon von utopischer Harmonie.
 Dreht man daraufhin am
Schwarzweiß-„Color Wheel“ Alex Ross Perrys, hat sich in
Sachen Enthemmung wiederum gar wenig bewegt – und das mit über 40
Jahren Fortschritt im land of the free. Perry zeichnet seine
Generation und folgerichtig sich selbst binnen einer der Hauptrollen
für die Ironisierung einer emotionalen Distanz zugänglich, der es
an kollektiver Beziehungsunfähigkeit krankt, eine Vielfalt der
Degradierung in der Bekenntnis zueinander vor sich hin murmelt. In
dem Fall ist es natürlich auch Familiensache sowie an einem Roadtrip
exemplifiziert, der den Griswolds
ähnlich auf die Dynamik des Dysfunktionellen angewiesen ist, um der
Ungerechtigkeit des Seins entgegenzutreten. Lässt sich daran etwas
ausrichten, wenn die Katharsis in beiden Varianten letztendlich zur
temporär befriedigenden Verstörung sozialer Norm führt? Bei Perry
äußert sie sich noch selbstbewusster als
Anarcho-Geistesblitz aus Verzweiflung, innerhalb der
College-Geschwister Colin (Perry) und JR (Carlen Altman, auch
Ko-Autorin) auf einem Pfad des Meh-to-the-Future, bei welchem
der Zerfall der Sicherheit durchweg eine inzestuöse
Anziehungskraft/-neckerei verströmt. Perry macht eine Pointe der
Eitelkeit draus, als dass er der Empathie darin nachspürt, aber
sei's drum – diese Figuren sind bewusst eher anstrengend in ihrer
Fassung, auf einen Geräuschpegel der Konfrontation eingestellt, der
sich im Vornherein mit der Drahtbürste abtrocknet. Selbst die
garantierte Sympathie in der Zerstreuung religiöser Dogmen binnen
der Unterkunft im Christenhotel wirkt bei den beiden ganz gemein, so
wie Colin den Anlass mit Kotze eindeckt, JR den Sex anderer nebenan
der Soundkulisse wegen persifliert. Ist dann nur recht, wenn die
Reise dahin führen soll, ihre letzten Sachen aus der Wohnung des Ex
abzuholen, der von jener Frau schon nichts mehr wissen will. Beinahe
schon selbstverständlich addiert sich dazu der Umstand, dass es sich
dabei um ihren Uni-Professor handelt, so wie sich der Intellekt
ebenso in Perrys Nachfolgewerken
als potenzielle Komplementärfarbe des Zynismus addiert. In der
Mumblecore-Attitüde aller schwingen trotzdem zig brillante
Dialoge mit, denen man bei aller Ballung und Natürlichkeit stets nur
zu wenig Anerkennung zu schenken vermag – beim latenten Rassismus
Colins wundert es aber kaum, dass man ihm Wein in die Hemdtasche
schüttet; dass die im Verlauf spontane Erotik eher als Impuls des
Selbsthass wirkt.
Dreht man daraufhin am
Schwarzweiß-„Color Wheel“ Alex Ross Perrys, hat sich in
Sachen Enthemmung wiederum gar wenig bewegt – und das mit über 40
Jahren Fortschritt im land of the free. Perry zeichnet seine
Generation und folgerichtig sich selbst binnen einer der Hauptrollen
für die Ironisierung einer emotionalen Distanz zugänglich, der es
an kollektiver Beziehungsunfähigkeit krankt, eine Vielfalt der
Degradierung in der Bekenntnis zueinander vor sich hin murmelt. In
dem Fall ist es natürlich auch Familiensache sowie an einem Roadtrip
exemplifiziert, der den Griswolds
ähnlich auf die Dynamik des Dysfunktionellen angewiesen ist, um der
Ungerechtigkeit des Seins entgegenzutreten. Lässt sich daran etwas
ausrichten, wenn die Katharsis in beiden Varianten letztendlich zur
temporär befriedigenden Verstörung sozialer Norm führt? Bei Perry
äußert sie sich noch selbstbewusster als
Anarcho-Geistesblitz aus Verzweiflung, innerhalb der
College-Geschwister Colin (Perry) und JR (Carlen Altman, auch
Ko-Autorin) auf einem Pfad des Meh-to-the-Future, bei welchem
der Zerfall der Sicherheit durchweg eine inzestuöse
Anziehungskraft/-neckerei verströmt. Perry macht eine Pointe der
Eitelkeit draus, als dass er der Empathie darin nachspürt, aber
sei's drum – diese Figuren sind bewusst eher anstrengend in ihrer
Fassung, auf einen Geräuschpegel der Konfrontation eingestellt, der
sich im Vornherein mit der Drahtbürste abtrocknet. Selbst die
garantierte Sympathie in der Zerstreuung religiöser Dogmen binnen
der Unterkunft im Christenhotel wirkt bei den beiden ganz gemein, so
wie Colin den Anlass mit Kotze eindeckt, JR den Sex anderer nebenan
der Soundkulisse wegen persifliert. Ist dann nur recht, wenn die
Reise dahin führen soll, ihre letzten Sachen aus der Wohnung des Ex
abzuholen, der von jener Frau schon nichts mehr wissen will. Beinahe
schon selbstverständlich addiert sich dazu der Umstand, dass es sich
dabei um ihren Uni-Professor handelt, so wie sich der Intellekt
ebenso in Perrys Nachfolgewerken
als potenzielle Komplementärfarbe des Zynismus addiert. In der
Mumblecore-Attitüde aller schwingen trotzdem zig brillante
Dialoge mit, denen man bei aller Ballung und Natürlichkeit stets nur
zu wenig Anerkennung zu schenken vermag – beim latenten Rassismus
Colins wundert es aber kaum, dass man ihm Wein in die Hemdtasche
schüttet; dass die im Verlauf spontane Erotik eher als Impuls des
Selbsthass wirkt.
 Blickt man noch weiter zurück, liegen
die Wurzeln dafür auch in Filmen wie „Gangster in Key Largo“
bereit, jenem Spannungsstück John Hustons, das in der Nachlese
des Zweiten Weltkriegs zur bestehenden Amoral der menschlichen Natur
Stellung nahm, ohne den reinen Antagonismus daran festzustellen. Die
Gefahr ist dennoch ein ständiger Begleiter für Major Frank McCloud
(Humphrey Bogart), selbst wenn er das Hotel seines alten Freundes
James Temple (Lionel Barrymore, „Ist
das Leben nicht schön?“) binnen der Key-Largo-Insel gen
Florida besucht; zwar die Risiken eines wiederkehrenden Hurrikans in
Kauf nehmen kann, aber nur bedingt die Belagerung durch skrupellose
Verbrecher unter Führung der berüchtigten Milieugröße Johnny
Rocco (Edward G. Robinson). Der und seine Schergen sind zwar selbst
nur Überbleibsel einer vergangenen Ära, doch weiterhin Urheber
eines langsam anpirschenden Terrors, der dabei zwangsläufig Zyklen
der Selbstzerstörung eingeht und willens ist, alle mit sich
herunterzuziehen. Die klassischen Signale der Edelmut können da nur
wie bestellt und nicht abgeholt dreinschauen, doch sie spielen ihre
Fassungslosigkeit zunehmend als Verhandlungsbasis aus, so wie sich
die Gleichung von Gut und Böse scheinbar immer mehr von externen
Faktoren abhängig macht. Bogarts Positionierung im Kammerspiel der
Bedrohung mahnt nicht von ungefähr an den „Versteinerten
Wald“, wenn die Natur ebenso Boten vorausschickt, Traumata und
Schuld an/wegzuschwemmen, die sich seitdem als verstärkte Faktoren
binnen Realität wie Leinwand kristallisiert haben, von der Größe
vergangener Zeiten sprechen und trotzdem nur eine Hinterlassenschaft
der Schmerzen nachweisen können. Eine neue Generation via
Temple-Tochter Nora (Lauren Bacall), Migranten und Ureinwohnern
versucht die Knüpfung eines Neuanfangs, begegnet jedoch
verschlossenen Türen, Gesetzeshütern trivialer Auffassungsgabe,
eben einer Machtlosigkeit gegenüber dem Status von Geld und Waffe,
vor dem alle auf einmal kuschen müssen und Huston umso dringlicher
die Klaustrophobie einer Gefangenschaft zeichnet – vor allem, wenn
sie keiner Partei die Flucht einheimsen kann. Alle stehen unter
Zugzwang, auch sich selbst gegenüber in einem Set, das sogar die
natürlichste Oase an versprochenem Frieden nur als Konstruktion
gepachtet hat, auf den Schreckmoment genau von Blitzen, Sturmregen,
Nacht und Nebel umringt wird. Der Sog daran ist allerdings durchweg
echt geblieben, quasi als Zerreißprobe gegen alle Zerreißproben.
Blickt man noch weiter zurück, liegen
die Wurzeln dafür auch in Filmen wie „Gangster in Key Largo“
bereit, jenem Spannungsstück John Hustons, das in der Nachlese
des Zweiten Weltkriegs zur bestehenden Amoral der menschlichen Natur
Stellung nahm, ohne den reinen Antagonismus daran festzustellen. Die
Gefahr ist dennoch ein ständiger Begleiter für Major Frank McCloud
(Humphrey Bogart), selbst wenn er das Hotel seines alten Freundes
James Temple (Lionel Barrymore, „Ist
das Leben nicht schön?“) binnen der Key-Largo-Insel gen
Florida besucht; zwar die Risiken eines wiederkehrenden Hurrikans in
Kauf nehmen kann, aber nur bedingt die Belagerung durch skrupellose
Verbrecher unter Führung der berüchtigten Milieugröße Johnny
Rocco (Edward G. Robinson). Der und seine Schergen sind zwar selbst
nur Überbleibsel einer vergangenen Ära, doch weiterhin Urheber
eines langsam anpirschenden Terrors, der dabei zwangsläufig Zyklen
der Selbstzerstörung eingeht und willens ist, alle mit sich
herunterzuziehen. Die klassischen Signale der Edelmut können da nur
wie bestellt und nicht abgeholt dreinschauen, doch sie spielen ihre
Fassungslosigkeit zunehmend als Verhandlungsbasis aus, so wie sich
die Gleichung von Gut und Böse scheinbar immer mehr von externen
Faktoren abhängig macht. Bogarts Positionierung im Kammerspiel der
Bedrohung mahnt nicht von ungefähr an den „Versteinerten
Wald“, wenn die Natur ebenso Boten vorausschickt, Traumata und
Schuld an/wegzuschwemmen, die sich seitdem als verstärkte Faktoren
binnen Realität wie Leinwand kristallisiert haben, von der Größe
vergangener Zeiten sprechen und trotzdem nur eine Hinterlassenschaft
der Schmerzen nachweisen können. Eine neue Generation via
Temple-Tochter Nora (Lauren Bacall), Migranten und Ureinwohnern
versucht die Knüpfung eines Neuanfangs, begegnet jedoch
verschlossenen Türen, Gesetzeshütern trivialer Auffassungsgabe,
eben einer Machtlosigkeit gegenüber dem Status von Geld und Waffe,
vor dem alle auf einmal kuschen müssen und Huston umso dringlicher
die Klaustrophobie einer Gefangenschaft zeichnet – vor allem, wenn
sie keiner Partei die Flucht einheimsen kann. Alle stehen unter
Zugzwang, auch sich selbst gegenüber in einem Set, das sogar die
natürlichste Oase an versprochenem Frieden nur als Konstruktion
gepachtet hat, auf den Schreckmoment genau von Blitzen, Sturmregen,
Nacht und Nebel umringt wird. Der Sog daran ist allerdings durchweg
echt geblieben, quasi als Zerreißprobe gegen alle Zerreißproben.
 Komisch ist, dass ich bei Hong Sang-soo
selten Überraschungen, sprich eine Abwandlung seiner Stilistik
erwarte, so wie mir seine Markenzeichen und Themengebiete inzwischen
ans Herz gewachsen sind; gleichsam auf eine Vielfalt der
Liebenswürdigkeiten sowie des Humors hoffe, wie es einen z.B. bei
„Right
Now, Wrong Then“ erwischte. Viellicht liegt es auch nur daran,
dass ich in der Woche schon „Haewon und die Männer“ von
ihm gesichtet hatte, auf jeden Fall war ich kurz darauf nicht allzu
gebannt von „Ha Ha Ha – Das Leben ist ein Witz“
eingenommen, der sich in knapp zwei Stunden Laufzeit (ungewöhnlich
lang für den Mann) erneut darauf berief, wie variabel die Funktion
des Geschichtenerzählens auf dessen Protagonisten abfärbt, wie sich
deren Erfahrungen kreuzen und die Balance des jeweiligen Herzens in
eine Falle der Sehnsucht schleusen, wenn sich auch jedermann
irgendwann im Zweierprofil zwischen reihenweise Soju-Flaschen
wiederfindet. Interessant bleibt, wie allumfassend die Bindung zu
Traditionen, inner- wie außerfamiliären Beziehungen auf die
Gezeiten geprägt wird, allen voran im männlichen Spektrum auf die
Untragbarkeit jener etablierter Ideale (auch jene der Künste)
hinsteuert und die Gnade darin findet, dass kein Mensch unfehlbar mit
beiden Beinen im Leben stehen kann. Verehrter Hong, das ging
trotzdem schon mal effizienter durch deine Hand in den Verstand, im
Grunde auch ohne diesen Hang zur Romantisierung, den du dir
normalerweise für Traumsequenzen aufhebst und jene umso stärker
wirken lässt, wenn man sie genauso gut untrennbar mit dem sonstigen
Geschehen der Leinwand, sprich dem Wunschwesen der Charaktere
verstehen kann. Ich gebe zu, das ist alles noch fernab von
„Alles-ist-verbunden“-Allgemeinplätzen, die sich seit
„Traffic“ ins Weltkino eingenistet haben und inzwischen
furchtbar verkitscht daherkommen – aber im Grunde lässt sich jede
Formel eventuell überholen, auch wenn die Details darin weiterhin
voll wahrhaftig Bittersüßen aufs Glück (zu zweit) hoffen. Die
Pillensucht gegen die Depression ringt hier ums Lachen, das Lachen
neben Wohnung und Job um die Gunst einer unnahbar temperamentvollen
Schönheit von nebenan, jene Frau um eine Würde nach Format des
Admirals Yi Sun-sin. Bei den Konstellationen im Zeitgeist-Querschnitt
kann ja nur mehrmals geweint werden – oder man säuft sich Mut an.
Komisch ist, dass ich bei Hong Sang-soo
selten Überraschungen, sprich eine Abwandlung seiner Stilistik
erwarte, so wie mir seine Markenzeichen und Themengebiete inzwischen
ans Herz gewachsen sind; gleichsam auf eine Vielfalt der
Liebenswürdigkeiten sowie des Humors hoffe, wie es einen z.B. bei
„Right
Now, Wrong Then“ erwischte. Viellicht liegt es auch nur daran,
dass ich in der Woche schon „Haewon und die Männer“ von
ihm gesichtet hatte, auf jeden Fall war ich kurz darauf nicht allzu
gebannt von „Ha Ha Ha – Das Leben ist ein Witz“
eingenommen, der sich in knapp zwei Stunden Laufzeit (ungewöhnlich
lang für den Mann) erneut darauf berief, wie variabel die Funktion
des Geschichtenerzählens auf dessen Protagonisten abfärbt, wie sich
deren Erfahrungen kreuzen und die Balance des jeweiligen Herzens in
eine Falle der Sehnsucht schleusen, wenn sich auch jedermann
irgendwann im Zweierprofil zwischen reihenweise Soju-Flaschen
wiederfindet. Interessant bleibt, wie allumfassend die Bindung zu
Traditionen, inner- wie außerfamiliären Beziehungen auf die
Gezeiten geprägt wird, allen voran im männlichen Spektrum auf die
Untragbarkeit jener etablierter Ideale (auch jene der Künste)
hinsteuert und die Gnade darin findet, dass kein Mensch unfehlbar mit
beiden Beinen im Leben stehen kann. Verehrter Hong, das ging
trotzdem schon mal effizienter durch deine Hand in den Verstand, im
Grunde auch ohne diesen Hang zur Romantisierung, den du dir
normalerweise für Traumsequenzen aufhebst und jene umso stärker
wirken lässt, wenn man sie genauso gut untrennbar mit dem sonstigen
Geschehen der Leinwand, sprich dem Wunschwesen der Charaktere
verstehen kann. Ich gebe zu, das ist alles noch fernab von
„Alles-ist-verbunden“-Allgemeinplätzen, die sich seit
„Traffic“ ins Weltkino eingenistet haben und inzwischen
furchtbar verkitscht daherkommen – aber im Grunde lässt sich jede
Formel eventuell überholen, auch wenn die Details darin weiterhin
voll wahrhaftig Bittersüßen aufs Glück (zu zweit) hoffen. Die
Pillensucht gegen die Depression ringt hier ums Lachen, das Lachen
neben Wohnung und Job um die Gunst einer unnahbar temperamentvollen
Schönheit von nebenan, jene Frau um eine Würde nach Format des
Admirals Yi Sun-sin. Bei den Konstellationen im Zeitgeist-Querschnitt
kann ja nur mehrmals geweint werden – oder man säuft sich Mut an. Ob sich etwas Schönes aus Propaganda
schöpfen lässt, wollte ich mit der nötigen Vorsicht erneut
feststellen, als es darum ging, den allerersten Anime in
Spielfilmlänge, „Momotarô: Umi no shinpei“, zu sichten.
Könnte man den Film von Mitsuyo Seo auf seine historische
Kunstfertigkeit reduzieren, wäre man bei einem verspielten
Traumtänzeln zugange, das der Bewältigung der Furcht eine Einigkeit
voll malerischer Grenzenlosigkeit verinnerlichen konnte. Der
Surrealismus binnen der Glorifizierung und Verharmlosung des
Kriegstreibens anno 1945 ist jedoch nicht bloß eine trügerische
Angelegenheit voller Widersprüche zwischen Kunst und Funktion,
sondern angesichts der Konsequenzen im Nachhinein auch eine voller
Tragik und Fahrlässigkeit, wie überzogen sich die Überzeugung hier
selbst besingt und nur schwer vorstellen wollte, dass ein
verhängnisvolles Ende dessen möglich war. Anhand einer
anthropomorphen Tierwelt, die trotzdem von einigen menschlichen
Würdenträgern und Witzfiguren an Alliierten bevölkert ist,
zeichnet man den Ruhm der japanischen Fliegerstaffel vor, die in
ihrer Heimat ein hohes, nationalistisch-jingoistisches Ansehen
bekleidet, stolz und demütig zugleich vor Tälern, Feldern und der
Sonne steht; sicher stellt, dass Tapferkeit und innere Führung
selbst bei kleineren wie größeren Krisen den Tag retten können. In
jener Anfangsphase äußert sich die Ideologie vielleicht noch
weniger bestimmt als filigrane Sage der Gemeinschaft, verlässt sich
ohnehin mehr auf eine Erzählung ohne Dialoge, zu welcher sich eine
aus den Kinderschuhen entwachsene Faszination zur Lebendigkeit via
Animation erahnen lässt. Einige frühe Tricks mit der Ebenenschärfe
sowie die Behutsamkeit zur Atmosphäre/Verknüpfung mit der Natur
kommen ebenso als Herzenssache an, doch spätestens sobald der
martialische Schaffensdrang auf pazifischen Inseln die Stimmung
einnimmt, ist jede Unschuld ausradiert bzw. zweckentfremdet. Die
Überlegenheit des Waffenapparates ist hier als Bildungsauftrag und Futterfest im
Musicalformat aufgelöst, dramaturgisch erst recht auf ein
selbstgenügsames Nichts reduziert, das seine niedlichen Fabelwesen
auf Slapstick eicht, ehe die Zeichen der Zerstörung im Gewissen
ankommen sollen. Von der Gegnerseite her sieht man zwar stille
Nachspiele, jedoch solche ohne Opfer, bis dann schließlich der
Rückschlag in reißerischen Kontrasten (inkl. On-Screen-Bodycount)
stattfindet - gefolgt von einer US-Kapitulation, die in ihrer
Lächerlichkeit nicht mal einen Stereotyp, nur die Schwäche des
Gegenübers feststellen will. Bei allen Tiervergleichen eine
unmenschliche und fatale Naivität.
Ob sich etwas Schönes aus Propaganda
schöpfen lässt, wollte ich mit der nötigen Vorsicht erneut
feststellen, als es darum ging, den allerersten Anime in
Spielfilmlänge, „Momotarô: Umi no shinpei“, zu sichten.
Könnte man den Film von Mitsuyo Seo auf seine historische
Kunstfertigkeit reduzieren, wäre man bei einem verspielten
Traumtänzeln zugange, das der Bewältigung der Furcht eine Einigkeit
voll malerischer Grenzenlosigkeit verinnerlichen konnte. Der
Surrealismus binnen der Glorifizierung und Verharmlosung des
Kriegstreibens anno 1945 ist jedoch nicht bloß eine trügerische
Angelegenheit voller Widersprüche zwischen Kunst und Funktion,
sondern angesichts der Konsequenzen im Nachhinein auch eine voller
Tragik und Fahrlässigkeit, wie überzogen sich die Überzeugung hier
selbst besingt und nur schwer vorstellen wollte, dass ein
verhängnisvolles Ende dessen möglich war. Anhand einer
anthropomorphen Tierwelt, die trotzdem von einigen menschlichen
Würdenträgern und Witzfiguren an Alliierten bevölkert ist,
zeichnet man den Ruhm der japanischen Fliegerstaffel vor, die in
ihrer Heimat ein hohes, nationalistisch-jingoistisches Ansehen
bekleidet, stolz und demütig zugleich vor Tälern, Feldern und der
Sonne steht; sicher stellt, dass Tapferkeit und innere Führung
selbst bei kleineren wie größeren Krisen den Tag retten können. In
jener Anfangsphase äußert sich die Ideologie vielleicht noch
weniger bestimmt als filigrane Sage der Gemeinschaft, verlässt sich
ohnehin mehr auf eine Erzählung ohne Dialoge, zu welcher sich eine
aus den Kinderschuhen entwachsene Faszination zur Lebendigkeit via
Animation erahnen lässt. Einige frühe Tricks mit der Ebenenschärfe
sowie die Behutsamkeit zur Atmosphäre/Verknüpfung mit der Natur
kommen ebenso als Herzenssache an, doch spätestens sobald der
martialische Schaffensdrang auf pazifischen Inseln die Stimmung
einnimmt, ist jede Unschuld ausradiert bzw. zweckentfremdet. Die
Überlegenheit des Waffenapparates ist hier als Bildungsauftrag und Futterfest im
Musicalformat aufgelöst, dramaturgisch erst recht auf ein
selbstgenügsames Nichts reduziert, das seine niedlichen Fabelwesen
auf Slapstick eicht, ehe die Zeichen der Zerstörung im Gewissen
ankommen sollen. Von der Gegnerseite her sieht man zwar stille
Nachspiele, jedoch solche ohne Opfer, bis dann schließlich der
Rückschlag in reißerischen Kontrasten (inkl. On-Screen-Bodycount)
stattfindet - gefolgt von einer US-Kapitulation, die in ihrer
Lächerlichkeit nicht mal einen Stereotyp, nur die Schwäche des
Gegenübers feststellen will. Bei allen Tiervergleichen eine
unmenschliche und fatale Naivität.
 Einen gewissen moralischen Kompass muss
man in Sachen Film ja vertreten können, bei „Draculas
Hexenjagd“ wird allerdings mit zweierlei Maß gemessen, bis
letzten Endes doch die mittelschwer konservativste Lösung in die
gotische Phantastik einkehrt. Die Hammer-Studios waren sich
bei Einzug der 70er Jahre nicht sicher, ob ihr dazumal schon
klassischer Horror noch eine Chance in der internationalen Eskalation
an Schauwerten haben könne, von daher sollte die Rekrutierung der
Playmate-Sisters Madeleine und Mary Collinson einen Sexappeal
signalisieren, der sich gleichsam vor keiner Blutschröpfung scheuen
würde. So ganz der Exploitation anvertrauen wollte man sich
dann doch nicht, im Gegenteil: Anhand von Hexenjäger Gustav Weil
(Peter Cushing) hegt der Film sogar ambivalente Gefühle, ob der
Prozess der Hexenverbrennung nicht sogar seine Berechtigung
hatte, indem er dem Aberglauben insofern Recht gibt, dass die Frauen
unter der Obhut des vom Satan angebissenen Graf Karnstein (Damien
Thomas) - inkl. rassistisch stilisiertem Sidekick Joachim (Roy
Stewart) - absolut zu vernichten seien. Der erzkatholische wet
dream wird insofern noch hinterfragt, dass Cembalo-Lehrer Anton
Hoffer (David Warbeck) die reaktionäre Willkür von Weil eines
Besseren belehrt; als Sprachrohr des Zuschauers ohnehin zu Protokoll
gibt, wie unbeliebt die Truppe der Rächer im Dorf ankommt. Doch
selbst wenn man die Abneigung gegen den Mob projiziert bekommen soll:
Ein Cushing wird bei Hammer nie zum totalen Ekel, parallel
dazu züchtigt man dann auch der Würde halber die Ausgabe an nacktem
Fleisch auf zurückhaltende Dekolletés und Satansriten, ehe ein
magic moment vonseiten der Collinsons im dritten Akt
ausgepackt wird. Less is more am Arsch. Weil ich aber nicht
bloß als notgeil verbleiben will, möchte ich die durchweg
stringende Immersion in jene tristbigotte Dorffolklore loben, die
unseren (eher funktionell spielenden) Zwillingen Frieda und
Maria nur bedingt zusagt, ehe Frieda nachts das Weite sucht und bei
besagtem Agent Provokateur mit Kaiserschein Karnstein als
williges Beißergirl vorstellig wird. Maria kann diese Aktionen nicht
allzu lange decken, vom Misstrauen aus gibt’s bald Tote und einen
Story-Konsens, wie man ihn seiner drakonischen Spitzen wegen
ausschließlich in der Menge an Spezialeffekten messen soll. Also
nichts gegen Routine, aber bei den Mädels ist die hiesige
Verzögerungstaktik eine offensichtlich verklemmte Ausrede.
Einen gewissen moralischen Kompass muss
man in Sachen Film ja vertreten können, bei „Draculas
Hexenjagd“ wird allerdings mit zweierlei Maß gemessen, bis
letzten Endes doch die mittelschwer konservativste Lösung in die
gotische Phantastik einkehrt. Die Hammer-Studios waren sich
bei Einzug der 70er Jahre nicht sicher, ob ihr dazumal schon
klassischer Horror noch eine Chance in der internationalen Eskalation
an Schauwerten haben könne, von daher sollte die Rekrutierung der
Playmate-Sisters Madeleine und Mary Collinson einen Sexappeal
signalisieren, der sich gleichsam vor keiner Blutschröpfung scheuen
würde. So ganz der Exploitation anvertrauen wollte man sich
dann doch nicht, im Gegenteil: Anhand von Hexenjäger Gustav Weil
(Peter Cushing) hegt der Film sogar ambivalente Gefühle, ob der
Prozess der Hexenverbrennung nicht sogar seine Berechtigung
hatte, indem er dem Aberglauben insofern Recht gibt, dass die Frauen
unter der Obhut des vom Satan angebissenen Graf Karnstein (Damien
Thomas) - inkl. rassistisch stilisiertem Sidekick Joachim (Roy
Stewart) - absolut zu vernichten seien. Der erzkatholische wet
dream wird insofern noch hinterfragt, dass Cembalo-Lehrer Anton
Hoffer (David Warbeck) die reaktionäre Willkür von Weil eines
Besseren belehrt; als Sprachrohr des Zuschauers ohnehin zu Protokoll
gibt, wie unbeliebt die Truppe der Rächer im Dorf ankommt. Doch
selbst wenn man die Abneigung gegen den Mob projiziert bekommen soll:
Ein Cushing wird bei Hammer nie zum totalen Ekel, parallel
dazu züchtigt man dann auch der Würde halber die Ausgabe an nacktem
Fleisch auf zurückhaltende Dekolletés und Satansriten, ehe ein
magic moment vonseiten der Collinsons im dritten Akt
ausgepackt wird. Less is more am Arsch. Weil ich aber nicht
bloß als notgeil verbleiben will, möchte ich die durchweg
stringende Immersion in jene tristbigotte Dorffolklore loben, die
unseren (eher funktionell spielenden) Zwillingen Frieda und
Maria nur bedingt zusagt, ehe Frieda nachts das Weite sucht und bei
besagtem Agent Provokateur mit Kaiserschein Karnstein als
williges Beißergirl vorstellig wird. Maria kann diese Aktionen nicht
allzu lange decken, vom Misstrauen aus gibt’s bald Tote und einen
Story-Konsens, wie man ihn seiner drakonischen Spitzen wegen
ausschließlich in der Menge an Spezialeffekten messen soll. Also
nichts gegen Routine, aber bei den Mädels ist die hiesige
Verzögerungstaktik eine offensichtlich verklemmte Ausrede.
 Ich genieße das Glück, in eine
echte Diktatur hineingeboren zu sein, doch noch froher bin ich,
seinerzeit kaum etwas davon mitbekommen zu haben. Ein weiteres
Zeugnis von der erschlagenden Tristesse der DDR habe ich mir wiederum
via „Heute abend und morgen früh“ zu Gemüte geführt und
obwohl das Ganze unter einer Stunde Laufzeit verbleibt, ist dessen
Querschnitt vom Alltag ein Hilfeschrei sondergleichen. Regisseur
Dietmar Hochmuth hatte in seinem späteren Werk nicht grundlos Kritik
am Prozess des regimefreundlichen Filmemachens genommen, in dieser
seiner Abschlussarbeit entwickelt man jedoch schon einen paranoiden
Krampf, wie viel Zufriedenheit der vermeintlich attraktiven
Lebensqualität entgegengebracht wird. Die Idealisierung bietet für
die namenlose Stomatologin (Christine Schorn) binnen
Ost-Berlin eben ein Kessel Buntes in Schwarz-Weiß;
Backstein-Bruchbruden, die Kino, Kunst, Welthandel und ein Bündel an
frohen wie kuriosen Bekanntschaften bereithalten, ehe der Tag voller
Versöhnlichkeit für die jungen Leute im Reihenhaus endet/anfängt,
um das Kind für die Schule bereit zu machen, mit dem Gatten (Rolf
Hoppe) in aller Kleine-Leute-Gemütlichkeit zu legieren. Wie so oft
im Kino der DDR mangelt es dem Image wegen an genuinem
Konfliktpotenzial, doch der Anspruch einer Wahrhaftigkeit binnen der
Gestaltung wäre noch weit perfider, würde Hochmuth nicht seine mehr
oder weniger subversiven Signale des Dissens austrahlen. Da wäre zum
einen der Soundtrack Günther Fischers, der genauso gut dem Abspann
eines Lucio-Fulci-Films entstammen könnte; passend dazu eine
verfolgende Steadicam, um welche man keine Absperrung oder
Statistenanweisung bemüht hat, weshalb jeder zweite Fußgänger in
die Linse schaut, teilweise Massen an Schaulustigen um eine Szene
versammelt. Umso verstörender lässt sich das mit der lockeren
Haltung der Protagonistin vereinbaren, die Flirts von vorbeifahrenden
Sowjetkarren empfängt, nachsynchronisierten Small Talk am
Bahnhofskiosk betreibt und auch nur wenig Bedenken bekundet, wenn der
Kommissar im Alleingang bei der Kundenschlange im
Tante-Emma-Laden um eine vermisste Person nachfragt. Diese Episoden
versprechen eine Verbundenheit des Miteinanders, den man im
Sozialstaat eben nur oberflächlich empfangen konnte, zeigen mit der
Kamera aber auch auf Polizisten nahe einer Kirche, von denen ich
sofort überzeugt war, dass sie gleich jemanden erschießen würden.
Unser von oben zuschauendes Ehepaar begnügt sich stattdessen mit dem
Frühstück, der gewitzten Moderne inklusive zerdeppertem
Gartenzwerg.
Ich genieße das Glück, in eine
echte Diktatur hineingeboren zu sein, doch noch froher bin ich,
seinerzeit kaum etwas davon mitbekommen zu haben. Ein weiteres
Zeugnis von der erschlagenden Tristesse der DDR habe ich mir wiederum
via „Heute abend und morgen früh“ zu Gemüte geführt und
obwohl das Ganze unter einer Stunde Laufzeit verbleibt, ist dessen
Querschnitt vom Alltag ein Hilfeschrei sondergleichen. Regisseur
Dietmar Hochmuth hatte in seinem späteren Werk nicht grundlos Kritik
am Prozess des regimefreundlichen Filmemachens genommen, in dieser
seiner Abschlussarbeit entwickelt man jedoch schon einen paranoiden
Krampf, wie viel Zufriedenheit der vermeintlich attraktiven
Lebensqualität entgegengebracht wird. Die Idealisierung bietet für
die namenlose Stomatologin (Christine Schorn) binnen
Ost-Berlin eben ein Kessel Buntes in Schwarz-Weiß;
Backstein-Bruchbruden, die Kino, Kunst, Welthandel und ein Bündel an
frohen wie kuriosen Bekanntschaften bereithalten, ehe der Tag voller
Versöhnlichkeit für die jungen Leute im Reihenhaus endet/anfängt,
um das Kind für die Schule bereit zu machen, mit dem Gatten (Rolf
Hoppe) in aller Kleine-Leute-Gemütlichkeit zu legieren. Wie so oft
im Kino der DDR mangelt es dem Image wegen an genuinem
Konfliktpotenzial, doch der Anspruch einer Wahrhaftigkeit binnen der
Gestaltung wäre noch weit perfider, würde Hochmuth nicht seine mehr
oder weniger subversiven Signale des Dissens austrahlen. Da wäre zum
einen der Soundtrack Günther Fischers, der genauso gut dem Abspann
eines Lucio-Fulci-Films entstammen könnte; passend dazu eine
verfolgende Steadicam, um welche man keine Absperrung oder
Statistenanweisung bemüht hat, weshalb jeder zweite Fußgänger in
die Linse schaut, teilweise Massen an Schaulustigen um eine Szene
versammelt. Umso verstörender lässt sich das mit der lockeren
Haltung der Protagonistin vereinbaren, die Flirts von vorbeifahrenden
Sowjetkarren empfängt, nachsynchronisierten Small Talk am
Bahnhofskiosk betreibt und auch nur wenig Bedenken bekundet, wenn der
Kommissar im Alleingang bei der Kundenschlange im
Tante-Emma-Laden um eine vermisste Person nachfragt. Diese Episoden
versprechen eine Verbundenheit des Miteinanders, den man im
Sozialstaat eben nur oberflächlich empfangen konnte, zeigen mit der
Kamera aber auch auf Polizisten nahe einer Kirche, von denen ich
sofort überzeugt war, dass sie gleich jemanden erschießen würden.
Unser von oben zuschauendes Ehepaar begnügt sich stattdessen mit dem
Frühstück, der gewitzten Moderne inklusive zerdeppertem
Gartenzwerg.
 Im Kino Hongkongs vor 1997 waren die
wildesten Genre-Verknüpfungen vertreten, um sich die
Schauwerte des Westens via der eigenen Filmindustrie ab Shaw
Brothers und Co. derart eigen zu machen, dass man heute noch dumm
aus der Wäsche schaut, wenn man deren Variante einer Actionkomödie wie „The Last Blood“ zu Gesicht bekommt. Tempo und
Ressourcenaufgebot hatte ich ja schon hinsichtlich Tsui Hark des
Öfteren hervorgehoben, womöglich aber noch nicht das Wechselbad an
Stimmungen, das mit den meist überbordenden Plots einhergeht –
Autorenfilmer Jing Wong demonstriert hier insofern eine Melange aus
Heroic-Bloodshed-Intrigen, Verfolgungsjagden und
Bleientscheidungen in Sekundenbruchteilen,
turbulenter Buddy-Comedy und spontanen
Religions-/Weltpolitik-/Extremismus-Überhöhungen, wie sie nur zu
gerne zwischen blutigem Terror-Knalleffekt und spritziger
Gesellschaftsverballhornung pendelt. Den Startschuss dafür
gibt der Bösewicht (Ho Chin) via der Roten Armee Japans ab, welcher mit einer Manie um sich reißt, die alsbald den Daka Lama als
nächste Zielscheibe auserwählt. Kommissar Lui Tai (Alan Tam) hält
jedoch clever und smart per trockenem Brillengestell dagegen und
führt einen Straight-Man-Kontrast gegenüber allen
Verrücktheiten zur Blüte, während endlos viele Kugeln und Körper
um ihn und Partner Stone (Ka-Yan Leung, hier als schwangerschaftsfokussierter Vater von sieben Mädels) herum fliegen, an jeder
öffentlichen Biegung eine explosive Wende nach der anderen reihen.
Diese ortsansässigen „Tango and Cash“ werden auch
damit beauftragt, den Lama zu beschützen, doch die Mörder stehen
schon auf der Rolltreppe und treffen ebenso die mit seinem
Schicksal verbundene Freundin von Kleinspurganove Bee (Andy Lau),
weshalb nun beide als Träger der seltensten Blutgruppe überhaupt
auf einen Spender angewiesen sind (weil alle anderen vorzeitig
abgemurkst wurden): Fatty (Eric Tsang), seines Titels gemäß ein
pummeliger Schwerenöter, der fortan stets auf der Flucht vor Cops
und Gangstern in jedes noch so kuriose Actionszenario stolpert, bis
ein dramatisches Massaker unter Unschuldigen nicht bloß einige
Western-Topoi inklusive falscher Fluppe auffrischt, sondern auch die
Krankenhausvisite von „Hard-Boiled“ vorwegnimmt, ohnehin
als Krachklamaukvariante von „Lethal
Warrior“ verstanden werden kann. Pyrotechnisch und
vehikelschrottend ist man hier also auf Eskalationskurs eingestellt,
im Dialog umso hysterischer am Bashen, wovon auch die
weisesten Religionsoberhäupter nicht verschont bleiben – nur die
Spitze des Eisbergs binnen der Übersteuerung des drollig
zerfetzenden HK-Kochkessels.
Im Kino Hongkongs vor 1997 waren die
wildesten Genre-Verknüpfungen vertreten, um sich die
Schauwerte des Westens via der eigenen Filmindustrie ab Shaw
Brothers und Co. derart eigen zu machen, dass man heute noch dumm
aus der Wäsche schaut, wenn man deren Variante einer Actionkomödie wie „The Last Blood“ zu Gesicht bekommt. Tempo und
Ressourcenaufgebot hatte ich ja schon hinsichtlich Tsui Hark des
Öfteren hervorgehoben, womöglich aber noch nicht das Wechselbad an
Stimmungen, das mit den meist überbordenden Plots einhergeht –
Autorenfilmer Jing Wong demonstriert hier insofern eine Melange aus
Heroic-Bloodshed-Intrigen, Verfolgungsjagden und
Bleientscheidungen in Sekundenbruchteilen,
turbulenter Buddy-Comedy und spontanen
Religions-/Weltpolitik-/Extremismus-Überhöhungen, wie sie nur zu
gerne zwischen blutigem Terror-Knalleffekt und spritziger
Gesellschaftsverballhornung pendelt. Den Startschuss dafür
gibt der Bösewicht (Ho Chin) via der Roten Armee Japans ab, welcher mit einer Manie um sich reißt, die alsbald den Daka Lama als
nächste Zielscheibe auserwählt. Kommissar Lui Tai (Alan Tam) hält
jedoch clever und smart per trockenem Brillengestell dagegen und
führt einen Straight-Man-Kontrast gegenüber allen
Verrücktheiten zur Blüte, während endlos viele Kugeln und Körper
um ihn und Partner Stone (Ka-Yan Leung, hier als schwangerschaftsfokussierter Vater von sieben Mädels) herum fliegen, an jeder
öffentlichen Biegung eine explosive Wende nach der anderen reihen.
Diese ortsansässigen „Tango and Cash“ werden auch
damit beauftragt, den Lama zu beschützen, doch die Mörder stehen
schon auf der Rolltreppe und treffen ebenso die mit seinem
Schicksal verbundene Freundin von Kleinspurganove Bee (Andy Lau),
weshalb nun beide als Träger der seltensten Blutgruppe überhaupt
auf einen Spender angewiesen sind (weil alle anderen vorzeitig
abgemurkst wurden): Fatty (Eric Tsang), seines Titels gemäß ein
pummeliger Schwerenöter, der fortan stets auf der Flucht vor Cops
und Gangstern in jedes noch so kuriose Actionszenario stolpert, bis
ein dramatisches Massaker unter Unschuldigen nicht bloß einige
Western-Topoi inklusive falscher Fluppe auffrischt, sondern auch die
Krankenhausvisite von „Hard-Boiled“ vorwegnimmt, ohnehin
als Krachklamaukvariante von „Lethal
Warrior“ verstanden werden kann. Pyrotechnisch und
vehikelschrottend ist man hier also auf Eskalationskurs eingestellt,
im Dialog umso hysterischer am Bashen, wovon auch die
weisesten Religionsoberhäupter nicht verschont bleiben – nur die
Spitze des Eisbergs binnen der Übersteuerung des drollig
zerfetzenden HK-Kochkessels.
 Robert Altman, das ist jemand, den ich
bisher am ehesten mit seinem „Popeye“ in Verbindung
bringen konnte – das darauf erfolgte „Komm' zurück, Jimmy
Dean“ hat nun jedoch die besseren Chancen, einen Status als
Qualitätswerk auf Lebenszeit inne zu haben. Jene Erkenntnis
verschleiert natürlich nicht, wie ähnlich sich die Arbeiten
manchmal sind, mit dem jeweils an Lebhaftigkeit aufgestockten
Ensemble durch frei formbare Kulissen schlendern, kreuz und quer
kommunizieren, dass es Ambition wie Konstruktion daran
locker/minimalistisch macht, neben musikalischem Esprit und
interpersonellen Eigenarten aus jahrzehntelanger Bindung schließlich
ein Wiedersehen mit den Geistern der Familie als Konfrontation
der Herzen aufbietet. Das beinahe ausschließlich auf Frauen
konzentrierte Kammerspiel um den einigenden Kult der Legende James
Dean verabredet sich zudem zu einer Abrechnung, was die Haltbarkeit
einer Nostalgie angeht, die an der eigenen Vergänglichkeit vorbei
argumentiert, Schmerz als 50's-Americana dekoriert. Das
Arsenal an zuckersüßen Erinnerungen sucht sein Spiegelbild in der
konstanten Auf- und Abblende zur Theke des Kiosk Juanitas (Sudie
Bond), einer streng gläubigen Christin unter Provinzmädels mit dem
Banner der „Disciples of James Dean“ im Jubiläumstaumel.
Das reiterierte Aufleben im mehr oder weniger verklärten Ableben
jener Ikone stellt dann auch die persönlichen Bezüge an Existenzen
vor, die sich und ihre Vergangenheit bis aufs Weitere daran
definieren, allen voran Mona (Sandy Dennis), die seit jeher von ihrer
Liebesnacht mit dem Hollywoodhünen überzeugt ist und den
gemeinsamen Sohn nach ihm getauft hat. Dass man diesen nie
sieht, ihm aber ständig nachgerufen wird, erzählt schon reichlich
von der verkopften Kuppel des bannenden Traumas aller, das in seiner
Stille ringsum mehrmals die Jukebox anschmeißt, die ehemalige
Unbekümmertheit als Grabrede zur Brust nimmt und in derer
Reanimation umso verzweifelter zum Gift der Ideale greift, wenn der
eigentliche Charakter der Vergangenheit das mental image
verzerrt. Cher, Kathy Bates und Marta Heflin sind da ebenso an der
Anpassung gegenüber Joanne (Karen Black) beteiligt, während Altman
die Wechselwirkung der Wachstumsschmerzen vom ehemaligen Bühnenformat weg in der
individuellen Psyche/Trivialität/Wut zu Gewohnheit und Vorurteil verinnerlicht,
sich vielleicht auf vielerlei Geständnisse in Folge stützt,
aber durchweg die Natürlichkeit im Clinch mit der Wahrheit im
Einzelnen und Gemeinsamen für sich wirken lässt.
Robert Altman, das ist jemand, den ich
bisher am ehesten mit seinem „Popeye“ in Verbindung
bringen konnte – das darauf erfolgte „Komm' zurück, Jimmy
Dean“ hat nun jedoch die besseren Chancen, einen Status als
Qualitätswerk auf Lebenszeit inne zu haben. Jene Erkenntnis
verschleiert natürlich nicht, wie ähnlich sich die Arbeiten
manchmal sind, mit dem jeweils an Lebhaftigkeit aufgestockten
Ensemble durch frei formbare Kulissen schlendern, kreuz und quer
kommunizieren, dass es Ambition wie Konstruktion daran
locker/minimalistisch macht, neben musikalischem Esprit und
interpersonellen Eigenarten aus jahrzehntelanger Bindung schließlich
ein Wiedersehen mit den Geistern der Familie als Konfrontation
der Herzen aufbietet. Das beinahe ausschließlich auf Frauen
konzentrierte Kammerspiel um den einigenden Kult der Legende James
Dean verabredet sich zudem zu einer Abrechnung, was die Haltbarkeit
einer Nostalgie angeht, die an der eigenen Vergänglichkeit vorbei
argumentiert, Schmerz als 50's-Americana dekoriert. Das
Arsenal an zuckersüßen Erinnerungen sucht sein Spiegelbild in der
konstanten Auf- und Abblende zur Theke des Kiosk Juanitas (Sudie
Bond), einer streng gläubigen Christin unter Provinzmädels mit dem
Banner der „Disciples of James Dean“ im Jubiläumstaumel.
Das reiterierte Aufleben im mehr oder weniger verklärten Ableben
jener Ikone stellt dann auch die persönlichen Bezüge an Existenzen
vor, die sich und ihre Vergangenheit bis aufs Weitere daran
definieren, allen voran Mona (Sandy Dennis), die seit jeher von ihrer
Liebesnacht mit dem Hollywoodhünen überzeugt ist und den
gemeinsamen Sohn nach ihm getauft hat. Dass man diesen nie
sieht, ihm aber ständig nachgerufen wird, erzählt schon reichlich
von der verkopften Kuppel des bannenden Traumas aller, das in seiner
Stille ringsum mehrmals die Jukebox anschmeißt, die ehemalige
Unbekümmertheit als Grabrede zur Brust nimmt und in derer
Reanimation umso verzweifelter zum Gift der Ideale greift, wenn der
eigentliche Charakter der Vergangenheit das mental image
verzerrt. Cher, Kathy Bates und Marta Heflin sind da ebenso an der
Anpassung gegenüber Joanne (Karen Black) beteiligt, während Altman
die Wechselwirkung der Wachstumsschmerzen vom ehemaligen Bühnenformat weg in der
individuellen Psyche/Trivialität/Wut zu Gewohnheit und Vorurteil verinnerlicht,
sich vielleicht auf vielerlei Geständnisse in Folge stützt,
aber durchweg die Natürlichkeit im Clinch mit der Wahrheit im
Einzelnen und Gemeinsamen für sich wirken lässt.
 Der schwedische Regisseur Hasse Ekman
war seinerzeit zwar eng mit Ingmar Bergman verbandelt, aber nur
bedingt auf dessen Stufe angesehen, was man sich beim „Mädchen
mit den Hyazinthen“ zumindest soweit denken kann, dass er via
Genre auf die Spurensuche vom Leben verunglückter Seelen ging. Er
gibt sich vielleicht auch etwas ungeschickt darin, schon zu Beginn
den expliziten Hinweis zu hinterlassen, dass es um die Liebe von Frau
zu Frau geht, weshalb insbesondere der Schluss in seiner Redundanz
abfällt, dennoch nicht die Brisanz unterminiert, mit der sich bis
heute noch nicht jeder auseinanderzusetzen vermag (gilt übrigens
auch für „Jimmy Dean“). Im Zentrum dessen steht die junge
Dagmar Brink (Eva Henning), deren jüngster Lebensweg nach dem
narrativen Formate „Citizen Kanes“ aufgelöst wird,
allerdings weitaus finsterer den Strudel der Einsamkeit
rekonstruiert, der sie schließlich zum Selbstmord zwang. Und mit
finster mein ich das auch so, wie sich die Kulissen in Schwarz
und Regen verschließen, ausgeleerte Flaschen im Übermaß an
Verdrängung stehen lassen, sich den bisher unbekannten Nachbarn
anvertrauen, um via Schlaftablette ins Land der Träume geleitet
werden zu können. Anders (Ulf Palme) und Britt Wikner (Birgit
Tengroth) ersuchen nämlich die Gründe der an sie gerichteten
Erbschaft nach dem Ableben Dagmars, finden sich fortan in einer
Gesellschaft an emotional bis materiell gescheiterten Existenzen
wieder, die stets andere Erwartungen an Dagmar hegte, welche sie
(auch aus Bescheidenheit) entweder nicht durchscheinen lassen konnte
oder gar zu Missbrauch wie Vernachlässigung ihrer Person führte.
Die gedämpfte Stilisierung jener Prozesse schürt wie in „Key
Largo“ einen belasteten Menschenschlag nach Ende des Zweiten
Weltkriegs zusammen; der Zukunft und Gnade zur unerfüllten Sehnsucht
des Einzelnen ungewiss, wobei alle Entsagungen und Enttäuschungen
hier auch eine Schönheit im Leiden, eine Kunst des Verlorenen
erwirken und aneinander abprallen. Ekman betreibt trotzdem keine
ausschließliche/glorifizierte Misere, tatsächlich sogar eine
respektvoll aufeinander bauende Balance binnen Anders und Britt in
der ungewohnten Chance, Zugang zum Leben eines anderen zu erhalten,
es auf dessen Wunsch nachvollziehen zu können und das auch zu
wollen. Wie tief sich die menschliche Dissonanz jedoch verdunkeln
kann, ist hier als Melodram ohne Melodramatik schon zum Unikat
gereift.
Der schwedische Regisseur Hasse Ekman
war seinerzeit zwar eng mit Ingmar Bergman verbandelt, aber nur
bedingt auf dessen Stufe angesehen, was man sich beim „Mädchen
mit den Hyazinthen“ zumindest soweit denken kann, dass er via
Genre auf die Spurensuche vom Leben verunglückter Seelen ging. Er
gibt sich vielleicht auch etwas ungeschickt darin, schon zu Beginn
den expliziten Hinweis zu hinterlassen, dass es um die Liebe von Frau
zu Frau geht, weshalb insbesondere der Schluss in seiner Redundanz
abfällt, dennoch nicht die Brisanz unterminiert, mit der sich bis
heute noch nicht jeder auseinanderzusetzen vermag (gilt übrigens
auch für „Jimmy Dean“). Im Zentrum dessen steht die junge
Dagmar Brink (Eva Henning), deren jüngster Lebensweg nach dem
narrativen Formate „Citizen Kanes“ aufgelöst wird,
allerdings weitaus finsterer den Strudel der Einsamkeit
rekonstruiert, der sie schließlich zum Selbstmord zwang. Und mit
finster mein ich das auch so, wie sich die Kulissen in Schwarz
und Regen verschließen, ausgeleerte Flaschen im Übermaß an
Verdrängung stehen lassen, sich den bisher unbekannten Nachbarn
anvertrauen, um via Schlaftablette ins Land der Träume geleitet
werden zu können. Anders (Ulf Palme) und Britt Wikner (Birgit
Tengroth) ersuchen nämlich die Gründe der an sie gerichteten
Erbschaft nach dem Ableben Dagmars, finden sich fortan in einer
Gesellschaft an emotional bis materiell gescheiterten Existenzen
wieder, die stets andere Erwartungen an Dagmar hegte, welche sie
(auch aus Bescheidenheit) entweder nicht durchscheinen lassen konnte
oder gar zu Missbrauch wie Vernachlässigung ihrer Person führte.
Die gedämpfte Stilisierung jener Prozesse schürt wie in „Key
Largo“ einen belasteten Menschenschlag nach Ende des Zweiten
Weltkriegs zusammen; der Zukunft und Gnade zur unerfüllten Sehnsucht
des Einzelnen ungewiss, wobei alle Entsagungen und Enttäuschungen
hier auch eine Schönheit im Leiden, eine Kunst des Verlorenen
erwirken und aneinander abprallen. Ekman betreibt trotzdem keine
ausschließliche/glorifizierte Misere, tatsächlich sogar eine
respektvoll aufeinander bauende Balance binnen Anders und Britt in
der ungewohnten Chance, Zugang zum Leben eines anderen zu erhalten,
es auf dessen Wunsch nachvollziehen zu können und das auch zu
wollen. Wie tief sich die menschliche Dissonanz jedoch verdunkeln
kann, ist hier als Melodram ohne Melodramatik schon zum Unikat
gereift.
 Nun denn, es ward schon sehr
fortgeschritten in meinem 24-Stunden-Abenteuer, da sollte zur
Erquickung wieder ein Einstünder ins Land ziehen, von dem ich mir im
Vornherein schon eher weniger erhofft hatte und der selbst das noch
dem ersten Eindruck nach zu unterbieten schien: Ted V. Mikels „Dr.
Sex“, den ich hier vor allem aufgrund seines drolligen Posters
noch aufzählen wollte. Ansonsten ist die schnell
zusammengeschusterte Sexploitation innen drin immerhin noch
auf eine sympathische Schamlosigkeit reduziert, wie offensichtlich
der wissenschaftliche Anspruch vonseiten der Titelfigur (Victor Izay)
zu einem Quartett an Exempeln gestreckt wird, das sich mit dem
schäbigen und doch recht harmlosen Voyeurismus gegenüber
strippenden Damen in jeweils vier Wänden stets entschiedener
Kargheit begnügt. Die sexuellen Eigenarten an sich sind dann auch
eher parodistischer Natur, vom Intromonolog à la Russ Meyer als
Maßnahme zur Toleranz des Bizarren und Lachqualität gegenüber
gesellschaftlicher Unsicherheiten geeicht: Der eine denkt, er sei ein
Pudel fürs mehrmals Nachtnegligé tauschende Frauchen; der andere
kann sich Frauen und seiner Geschlechtsreife nur in der Form lebendig
gewordener Mannequins öffnen; eine Dame weiß nicht wohin mit
ihrem Exhibitionismus und landet nach lüstern talentlosen Künstlern
im Stripschuppen (wo gefühlt jeder Gast - auch Mikels selbst -
Augenklappe und Pfeife mitbringt); letzterem Patienten spuken dralle
Geister das Ideal der Hausfrau in die Bude – doch bei denen gilt:
Nur (ultrahoschig) gucken, nicht anfassen! Das findet der Doc so
toll, dass er das Domizil aus berufsbedingtem Enthusiasmus gleich
gekauft hat und mithilfe der Assistenz von Dr. Lovejoy (Julia Calda -
anfangs streng und doch eine fesche Maus) eine feuchtfröhliche Party
veranstaltet, zu der sich zudem oben genannter Pudel wieder aus
manchem Manne bildet, wenn diesem nicht vorher schon erneut dank
Looney-Tunes-Soundkulisse, Stopptricküberschuss und
Scherzartikelbudget die Augen aus den Höhlen fallen. Nackte
Tatsachen machen aus manchen Leuten eben Idioten, aus (dem leider 2016 verstorbenen) Mikels in dem
Fall weiterhin keinen berauschenden Filmemacher via seiner
Ressourcen. Aber gemessen am Titel und dem hochprozentigen Ulk
innerhalb jener schleppenden Seelenklempnerkomik habe ich dann doch
öfter vor Freude und Zermürbung gegluckst, als ich erwartet hätte.
Nun denn, es ward schon sehr
fortgeschritten in meinem 24-Stunden-Abenteuer, da sollte zur
Erquickung wieder ein Einstünder ins Land ziehen, von dem ich mir im
Vornherein schon eher weniger erhofft hatte und der selbst das noch
dem ersten Eindruck nach zu unterbieten schien: Ted V. Mikels „Dr.
Sex“, den ich hier vor allem aufgrund seines drolligen Posters
noch aufzählen wollte. Ansonsten ist die schnell
zusammengeschusterte Sexploitation innen drin immerhin noch
auf eine sympathische Schamlosigkeit reduziert, wie offensichtlich
der wissenschaftliche Anspruch vonseiten der Titelfigur (Victor Izay)
zu einem Quartett an Exempeln gestreckt wird, das sich mit dem
schäbigen und doch recht harmlosen Voyeurismus gegenüber
strippenden Damen in jeweils vier Wänden stets entschiedener
Kargheit begnügt. Die sexuellen Eigenarten an sich sind dann auch
eher parodistischer Natur, vom Intromonolog à la Russ Meyer als
Maßnahme zur Toleranz des Bizarren und Lachqualität gegenüber
gesellschaftlicher Unsicherheiten geeicht: Der eine denkt, er sei ein
Pudel fürs mehrmals Nachtnegligé tauschende Frauchen; der andere
kann sich Frauen und seiner Geschlechtsreife nur in der Form lebendig
gewordener Mannequins öffnen; eine Dame weiß nicht wohin mit
ihrem Exhibitionismus und landet nach lüstern talentlosen Künstlern
im Stripschuppen (wo gefühlt jeder Gast - auch Mikels selbst -
Augenklappe und Pfeife mitbringt); letzterem Patienten spuken dralle
Geister das Ideal der Hausfrau in die Bude – doch bei denen gilt:
Nur (ultrahoschig) gucken, nicht anfassen! Das findet der Doc so
toll, dass er das Domizil aus berufsbedingtem Enthusiasmus gleich
gekauft hat und mithilfe der Assistenz von Dr. Lovejoy (Julia Calda -
anfangs streng und doch eine fesche Maus) eine feuchtfröhliche Party
veranstaltet, zu der sich zudem oben genannter Pudel wieder aus
manchem Manne bildet, wenn diesem nicht vorher schon erneut dank
Looney-Tunes-Soundkulisse, Stopptricküberschuss und
Scherzartikelbudget die Augen aus den Höhlen fallen. Nackte
Tatsachen machen aus manchen Leuten eben Idioten, aus (dem leider 2016 verstorbenen) Mikels in dem
Fall weiterhin keinen berauschenden Filmemacher via seiner
Ressourcen. Aber gemessen am Titel und dem hochprozentigen Ulk
innerhalb jener schleppenden Seelenklempnerkomik habe ich dann doch
öfter vor Freude und Zermürbung gegluckst, als ich erwartet hätte.
 Von der Nikkatsu darf man sich
ja des Öfteren überzeugen, wie lustvoll deren Katalog mit jedem
Titel auf eine Sinnlichkeit stürmischer Dickköpfe zusteuert;
vielleicht nicht immer die leichteste Route binnen Nippon in Angriff
nimmt, um den Drang nach Sex seines Amtes walten zu lassen, aber bei
einem Beispiel wie „Horny Diver: Tight Shellfish“ aka
„Zetsurin ama: Shimari-gai“ noch nach ironischer joie
de vivre fischt. Um 1985 herum war das Format aber schon eher in
der Richtung zusammengestaucht, wie man es vom gegenwärtigen
Pinky-Angebot kennt, weshalb sich Atsushi Fujiuras Film vor
allem deshalb eher mittelmäßig einen von der Palme wedelt, da das
narrative Konstrukt auf Stichwörter eines Seifenoper-Konsens
reduziert bleibt und einer jeweils kurzen Einordnung jeder Szene
schon per Garantie ins nächste Betthüpferln übergeht. Dass man
sich solche Streifen hauptsächlich deswegen anschaut: Geschenkt!
Trotzdem kommt man um einen gewissen Grad der Ernüchterung nicht
umhin, weshalb man vorsichtshalber auch auf einen weiblichen Cast
zurückgegriffen hat, der sich seiner aufreizenden Schönheit zum
Wohle gepflegt durch mehrere Stellungen der Küstenregion kullern
lässt und trotz aller Zankereien im (zur Abwechslung mal nicht
sexuell konnotierten) Muscheltauchen den Großkapitalistencoup eines
fiesen Immobilienmaklers zu verhindern versucht. Zentral dafür darf
sich Yumi (Megumi Kiyosato) bewähren, deren Charakter keine
unscheinbare Wandlung durchmacht, anfangs noch bockig mit der
Halbschwester sowie der Applikation zu höherer Bildung hadert (=
Bücherverbrennen), ohnehin allen Männern den Kopf verdreht, aus
deren triebgesteuerter Frustration Intrigen wie Kapital schlägt; am
Ende aber doch die richtige Einstellung zu ihren Mitmenschen findet,
anstatt der Schuldentilgung per Hochzeit zum Ekel zuzusagen. Bis
dahin darf man sich als Zuschauer an einer Vielzahl nasser T-Shirts
erfreuen, zusätzlich an Nachtclubbesuchen mit vaginalen Trinkspielen
und Entladungen/Besteigungen in sonnigem Stillstand, wie es nur mit
einem herzlichen Winkeabschied am Hafen enden kann, sobald die wahre
Liebe obsiegt und das Banjo erneut zu „She'll be coming round
the mountain“ erklingt. Auf jeden Fall ist man
damit besser bedient, als mit der laut meinem Sichtungsplan danach
erfolgten „Separation“ von Jack Bond, die als
Godard-Suggorat mit einer Überzahl experimenteller Allegorien eher
zur Langeweile anregte – und das trotz der Notwendigkeit zur Emanzipation auf dem Ärmel!
Von der Nikkatsu darf man sich
ja des Öfteren überzeugen, wie lustvoll deren Katalog mit jedem
Titel auf eine Sinnlichkeit stürmischer Dickköpfe zusteuert;
vielleicht nicht immer die leichteste Route binnen Nippon in Angriff
nimmt, um den Drang nach Sex seines Amtes walten zu lassen, aber bei
einem Beispiel wie „Horny Diver: Tight Shellfish“ aka
„Zetsurin ama: Shimari-gai“ noch nach ironischer joie
de vivre fischt. Um 1985 herum war das Format aber schon eher in
der Richtung zusammengestaucht, wie man es vom gegenwärtigen
Pinky-Angebot kennt, weshalb sich Atsushi Fujiuras Film vor
allem deshalb eher mittelmäßig einen von der Palme wedelt, da das
narrative Konstrukt auf Stichwörter eines Seifenoper-Konsens
reduziert bleibt und einer jeweils kurzen Einordnung jeder Szene
schon per Garantie ins nächste Betthüpferln übergeht. Dass man
sich solche Streifen hauptsächlich deswegen anschaut: Geschenkt!
Trotzdem kommt man um einen gewissen Grad der Ernüchterung nicht
umhin, weshalb man vorsichtshalber auch auf einen weiblichen Cast
zurückgegriffen hat, der sich seiner aufreizenden Schönheit zum
Wohle gepflegt durch mehrere Stellungen der Küstenregion kullern
lässt und trotz aller Zankereien im (zur Abwechslung mal nicht
sexuell konnotierten) Muscheltauchen den Großkapitalistencoup eines
fiesen Immobilienmaklers zu verhindern versucht. Zentral dafür darf
sich Yumi (Megumi Kiyosato) bewähren, deren Charakter keine
unscheinbare Wandlung durchmacht, anfangs noch bockig mit der
Halbschwester sowie der Applikation zu höherer Bildung hadert (=
Bücherverbrennen), ohnehin allen Männern den Kopf verdreht, aus
deren triebgesteuerter Frustration Intrigen wie Kapital schlägt; am
Ende aber doch die richtige Einstellung zu ihren Mitmenschen findet,
anstatt der Schuldentilgung per Hochzeit zum Ekel zuzusagen. Bis
dahin darf man sich als Zuschauer an einer Vielzahl nasser T-Shirts
erfreuen, zusätzlich an Nachtclubbesuchen mit vaginalen Trinkspielen
und Entladungen/Besteigungen in sonnigem Stillstand, wie es nur mit
einem herzlichen Winkeabschied am Hafen enden kann, sobald die wahre
Liebe obsiegt und das Banjo erneut zu „She'll be coming round
the mountain“ erklingt. Auf jeden Fall ist man
damit besser bedient, als mit der laut meinem Sichtungsplan danach
erfolgten „Separation“ von Jack Bond, die als
Godard-Suggorat mit einer Überzahl experimenteller Allegorien eher
zur Langeweile anregte – und das trotz der Notwendigkeit zur Emanzipation auf dem Ärmel!
 So, zum Endspurt fassen wir nochmals
zwei Filme zusammen, weil mein Erinnerungsvermögen zu der Zeit, mit
knapp 21 Stunden Wachzustand und 13 Filmen im Vornherein, nicht mehr
vollkommen helle war, trotzdem ersehen konnte, dass die
D.H.-Lawrence-Verfilmung „The Fox“ nicht so verdichtet als
Psychogramm einer Gefühlsinvasion wie angedacht wirken konnte, da
der Anlass dazu, Keir Dulleas Fuchs im Hühnerstall Paul,
eher als Urheber einer basischen Genre-Intriganz genutzt wurde. Warum
da also mit Schauwerten und Binsenweisheiten vom Status der
Männlichkeit gearbeitet wird, um zu erklären, weshalb sich
Hühnerfarmbesitzerin Ellen March (Anne Heywood) seiner wegen ergibt,
obgleich sie eine Zuneigung zu Mitbetreiberin Jill (Sandy Dennis)
hegt und deswegen sogar eifersüchtig wird, erschließt sich mir nur
insofern, dass anno 1967 wohl eine Baukastenspannung vonnöten war,
anstatt die hitzige Dynamik zwischen Ellen und Jill für sich stehen
zu lassen. Dem Topos solch früher Herangehensweise zur
Homosexualität nach muss natürlich auch einer der beiden sterben,
wenn die Norm das Herz betrügt – wäre als Film auch nicht so
schlimm, wenn man die Kohärenz dazu nicht auf zwei Stunden und x
Tiervergleiche per Leone-Augenpartien forciert hätte. Der
gelungenere Abschluss erfolgte hingegen mit der „Modern Romance
– Muss denn Liebe Alptraum sein?“ von Albert Brooks, der sich
erneut selbst zum Zentrum einer desaströsen Herangehensweise in
Sachen Beziehungen einschreibt, wie man diese am besten auch aus
eigener Erfahrung kennt: Voller Unsicherheit zu überstürzten
Vermutungen und Ansagen neigend; am Vertrauen zum Partner der eigenen
Minderwertigkeitskomplexe wegen zweifelnd; in der Trennung dann enorm
überkompensierend, wenn aus dem Zwang zum Vergessen (k)ein
flotter Ersatz, eigentlich die nächstbeste Versöhnung umarmt wird,
als sei man alles andere als nachtragend. In dem On/Off-Rahmen wird
man jedoch nicht mit Zynismen bombardiert, wenn der persönliche
Anspruch Robert Coles (Brooks) jene
Passion/Kompromisslast/Durchsetzungskraft auch im Schneideraum
umzusetzen hat. Da findet Brooks eher seinen liebenswerten Versager
binnen der Bestätigung des Egos inmitten des 80er Kapitalismus, doch
der Kontrollanruf bei seiner starken Karrieredame Mary
(Kathryn Harrold) folgt auf rasantem Fuße hinterher. Die
Verlustangst ist eben in allen Bereichen des Seins zu groß gelagert,
in jedem Penthouse mit Quaaludes und Koks ausgestattet, dass sich
selbst George Kennedy am Set verirrt.
So, zum Endspurt fassen wir nochmals
zwei Filme zusammen, weil mein Erinnerungsvermögen zu der Zeit, mit
knapp 21 Stunden Wachzustand und 13 Filmen im Vornherein, nicht mehr
vollkommen helle war, trotzdem ersehen konnte, dass die
D.H.-Lawrence-Verfilmung „The Fox“ nicht so verdichtet als
Psychogramm einer Gefühlsinvasion wie angedacht wirken konnte, da
der Anlass dazu, Keir Dulleas Fuchs im Hühnerstall Paul,
eher als Urheber einer basischen Genre-Intriganz genutzt wurde. Warum
da also mit Schauwerten und Binsenweisheiten vom Status der
Männlichkeit gearbeitet wird, um zu erklären, weshalb sich
Hühnerfarmbesitzerin Ellen March (Anne Heywood) seiner wegen ergibt,
obgleich sie eine Zuneigung zu Mitbetreiberin Jill (Sandy Dennis)
hegt und deswegen sogar eifersüchtig wird, erschließt sich mir nur
insofern, dass anno 1967 wohl eine Baukastenspannung vonnöten war,
anstatt die hitzige Dynamik zwischen Ellen und Jill für sich stehen
zu lassen. Dem Topos solch früher Herangehensweise zur
Homosexualität nach muss natürlich auch einer der beiden sterben,
wenn die Norm das Herz betrügt – wäre als Film auch nicht so
schlimm, wenn man die Kohärenz dazu nicht auf zwei Stunden und x
Tiervergleiche per Leone-Augenpartien forciert hätte. Der
gelungenere Abschluss erfolgte hingegen mit der „Modern Romance
– Muss denn Liebe Alptraum sein?“ von Albert Brooks, der sich
erneut selbst zum Zentrum einer desaströsen Herangehensweise in
Sachen Beziehungen einschreibt, wie man diese am besten auch aus
eigener Erfahrung kennt: Voller Unsicherheit zu überstürzten
Vermutungen und Ansagen neigend; am Vertrauen zum Partner der eigenen
Minderwertigkeitskomplexe wegen zweifelnd; in der Trennung dann enorm
überkompensierend, wenn aus dem Zwang zum Vergessen (k)ein
flotter Ersatz, eigentlich die nächstbeste Versöhnung umarmt wird,
als sei man alles andere als nachtragend. In dem On/Off-Rahmen wird
man jedoch nicht mit Zynismen bombardiert, wenn der persönliche
Anspruch Robert Coles (Brooks) jene
Passion/Kompromisslast/Durchsetzungskraft auch im Schneideraum
umzusetzen hat. Da findet Brooks eher seinen liebenswerten Versager
binnen der Bestätigung des Egos inmitten des 80er Kapitalismus, doch
der Kontrollanruf bei seiner starken Karrieredame Mary
(Kathryn Harrold) folgt auf rasantem Fuße hinterher. Die
Verlustangst ist eben in allen Bereichen des Seins zu groß gelagert,
in jedem Penthouse mit Quaaludes und Koks ausgestattet, dass sich
selbst George Kennedy am Set verirrt.
Da habt ihr's! Und weil eine solche
Reihung an Werken nicht ohne eine Statistik im Rückspiegel der
Erfahrung auskommen kann, habe ich noch folgendes in petto: Der Witz
(und ein wichtiger Wachhalter) an der Sache war, dass ich eine
Strichliste geführt hatte, welche Themen zwischen den jeweiligen
Filmen immer und immer wieder auftauchten. Es war eine
Heidenüberraschung, soviel mag ich garantieren! Ohne die Werke und
deren Inhalte anhand dessen zu entlarven, hier nun also die Liste mit
jenen Zutaten, die in einer Auswahl von 15 Werken und wahrscheinlich
allen anderen Erfolgsgaranten darüber hinaus besonders präsent
waren:
(Legende: „Thema: Anzahl Filme“)
Familie/Beziehungen: 13
Lügen/Korruption: 13
Sex/Geschlechtsmerkmale: 12
Action/Prügel/Blut: 12
Rassismus/Sexismus: 12
Saufen/Rauchen/Andere Drogen: 12
Ärzte: 9
Singen/Tanzen: 9
Religion/Tradition: 9
Regen: 8
Schwarz-Weiß-Kamera: 7
Hunde: 6
Dichter/Pianospieler/Künstler: 6
Propaganda/Nationalismus: 6
Depression/Selbstmord: 6
Filmemachen: 5
Spiegel-Effekte: 5
Schwangerschaft: 4
Promi-Namedropping: 4
Zweiter Weltkrieg: 4
Kotzen: 3
Motorräder: 3
Rasur: 3
„Danke an den Koch“: 2
Sandy Dennis: 2
Sandy Dennis fragt, was denn so lustig
sei: 2