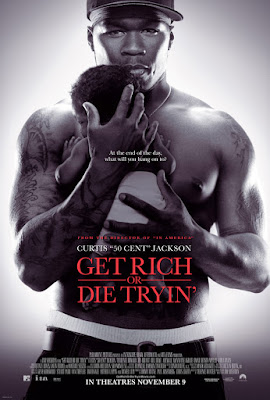Liebe Leser,
in den letzten Wochen war immer so viel los im Leben des
Witte, dass ich mein Hobby der Filmkritik zwangsläufig vernachlässigen musste.
Kleines Beispiel: Da ist ein Musikvideo erschienen, wo einige Einstellungen von
Kränen und Abrissbirnen meiner Kamera führenden Hand entstammen! So kann es
einem ergehen, aber denkt ja nicht, dass ich nur wenige gute Filme sah, oh no!
Hier hat sich von der reinen Menge her vieles angeboten, aber sobald ich mir
die Zeit nehmen wollte, lange und ausgiebig schriftlich darzulegen, warum sie
mir gefallen, machten mir externe Faktoren wieder einen Strich durch die
Rechnung. Sind halt jetzt andere Zeiten als noch vor 3 oder 4 Jahren. Habe
selber letztens drauf zurückgeblickt und war überwältigt, wie viel und in
welcher Menge an Abschnitten hier jeweils Woche für Woche an Filmen empfohlen
wurden! Aber es braucht keine Traurigkeit in solchen Zeilen – ich mach ja
weiter, nur anders (?)!
Das ist eventuell die Schlusspointe des neuesten Netflix-Release „Auslöschung“, aber da sind sich ja nicht alle einig, wo doch so
viele Theorien der Aufschlüsselung herumgereicht werden. Vielleicht ist’s eh nur eine künstliche
Aufregung um einen Film, der seinen Ruf nur bedingt einlösen kann. Zu komplex für den Kinoeinsatz sagen die
einen, Sci-Fi-Meilenstein proklamieren
die anderen. Ich will’s nicht so eng sehen, denn mir ging er höchstens im
Finale richtig nahe – da war Alex Garlands Inszenierung auf einmal so stark
konzentriert im Sog, so vom Bauchgefühl her und nonverbal im Kosmos unbekannter
Ängste und Mimikry herantastend, wie es der ganze Film gerne hätte sein können.
Vorher allerdings gibt er einen recht mäandernden Rahmen vor, wie genau das
Spannungsfeld erneuter außerirdischer Invasion zu verstehen ist: Eine
Expedition ins Herz der Finsternis als Selbstbeweis Natalie Portmans für die
Wissenschaft oder auch wahlweise den Ehegatten (Oscar Isaac) – von Anfang bis Ende so schicksalsschwer mit
Rückblenden und ausgestellten Mysterien beladen, dass es dem kollektiven
Schauspiel schon die Luft abwürgt. Portman allerdings ist seit jeher stets bemüht, echte
Menschen darzustellen – hier muss sie sich zudem in eine oberflächliche Crew
einreihen, die ihr Handeln zwar ausgiebig (manchmal auch sehr plump) verbalisieren, aber eben nur vom angeteaserten Rollentypus her (bzw. manchmal auch gar nicht) motivieren kann. Genauso verhält sich Regisseur Garland mit seiner fulminanten Bilderwelt,
die an sich eigentlich gut mit Faszination liebäugelt, aber stets auf Distanz bleibt,
ebenso frustrierend an der Immersion vorbeimontiert ist.
Man könnte argumentieren, dass das von der vorsichtigen Lösungssehnsucht der Charaktere herrührt - auf dem Papier sollen sie dann aber wiederum durchweg von Desorientierung und Angst gezeichnet sein, was in Filmform einiges an Überwältigung missen lässt; im Fall der etwas doll klischierten Gina Rodriguez am ehesten für Hysterie (und sogar Gore) sorgt. Ich hab den Vergleich schon auf Twitter gezogen, aber jene gedrückte Handhabe ging bei mir größtenteils nicht über den Habitus von „Transcendence“ hinaus (der ja auch positive Aspekte an sich hatte, nicht falsch verstehen). Es lässt sich auch nicht ganz von der Hand weisen, wie Garland das Verhältnis von Fragen und Antworten aufwiegt bzw. wie er die Deutung derer dem Zuschauer abnimmt – selbst wenn er sich in einer (nicht immer gelungenen) Verschachtelung übt, welche das labile Wesen des Menschen sowie seiner Wahrnehmung ins Gewissen rückt. Der Punkt ist durchaus die stichhaltigste Schlussfolgerung des Films, der darin auch Ängste der Übernahme aus unserer Gegenwart behüteter Identitäten reiht, als kämen die Körperfresser wieder zu Besuch. Dafür nimmt der Film aber auch einige Plattitüden an Menschenkenntnis in Kauf, die es einem einfacher als nötig machen und letztendlich halt auf eine Odyssee reißerischer Entdeckungen/Schocks abzielen (die Formulierung werde ich mir heute mehr als einmal erlauben). Von dem bewährten Konzept aus kann man dem Film noch gut folgen, allerdings war’s letztendlich doch ein beschwerlicher Weg aus obligatorischen Vertrauensfragen und Was-ist-das-erklärs-mir's hin zum finalen Rausch.
Man könnte argumentieren, dass das von der vorsichtigen Lösungssehnsucht der Charaktere herrührt - auf dem Papier sollen sie dann aber wiederum durchweg von Desorientierung und Angst gezeichnet sein, was in Filmform einiges an Überwältigung missen lässt; im Fall der etwas doll klischierten Gina Rodriguez am ehesten für Hysterie (und sogar Gore) sorgt. Ich hab den Vergleich schon auf Twitter gezogen, aber jene gedrückte Handhabe ging bei mir größtenteils nicht über den Habitus von „Transcendence“ hinaus (der ja auch positive Aspekte an sich hatte, nicht falsch verstehen). Es lässt sich auch nicht ganz von der Hand weisen, wie Garland das Verhältnis von Fragen und Antworten aufwiegt bzw. wie er die Deutung derer dem Zuschauer abnimmt – selbst wenn er sich in einer (nicht immer gelungenen) Verschachtelung übt, welche das labile Wesen des Menschen sowie seiner Wahrnehmung ins Gewissen rückt. Der Punkt ist durchaus die stichhaltigste Schlussfolgerung des Films, der darin auch Ängste der Übernahme aus unserer Gegenwart behüteter Identitäten reiht, als kämen die Körperfresser wieder zu Besuch. Dafür nimmt der Film aber auch einige Plattitüden an Menschenkenntnis in Kauf, die es einem einfacher als nötig machen und letztendlich halt auf eine Odyssee reißerischer Entdeckungen/Schocks abzielen (die Formulierung werde ich mir heute mehr als einmal erlauben). Von dem bewährten Konzept aus kann man dem Film noch gut folgen, allerdings war’s letztendlich doch ein beschwerlicher Weg aus obligatorischen Vertrauensfragen und Was-ist-das-erklärs-mir's hin zum finalen Rausch.
Etwas weniger als das bietet hingegen der
ebenfalls auf Netflix neugestartete „The Outsider“ an. Regisseur Martin
Zandvliet wollte ich da im Vertrauen mehr Kompetenz anrechnen, da ich seinen „Unter dem Sand“
noch für effektives Spannungskino verhärteter Fronten im Frieden hielt. Eben dessen Thema, wie ehemalige Kriegsfeinde zu Freunden
werden können, wie Schuld und Gewissen innerhalb neuer
Abhängigkeitsverhältnisse abzugleichen sind, mag ihn auch zu diesem Stoff
geführt haben – doch mit dem Herzstück an Kontrasten kommt er nicht weit, wenn
Jared Leto als G.I.-Yakuza-Konvolut sehr typische Genrepfade erneut bewandert
und aus rein stumpfer Anpassung ins Pathos ehrwürdiger Rache rutscht. Ich schätze, es geht ihm da noch um die mentalen Folgen von Militär und Kriegsgefangenschaft - Leto und Zandvliet wissen aber scheinbar kaum, wie sie diese Hülle an sich zumindest zur Hülle ausfüllen können.
Zudem scheint Zandvliet auch sein sonstiges inszenatorisches Geschick abhanden
gekommen zu sein. Anstatt Spannung zu ballen, verlässt er sich auf Steadicam-Strecken, Neonfarben und die
ältesten Kamellen von Schuss und Gegenschuss, um irgendwo ein Hauch von Zen
auszumachen. Es bleibt aber Wunschdenken, solange die Verhältnisse
untereinander mit Binsenweisheiten, Territorialdrohungen und reaktionärem Gangster-Einmaleins allein begossen werden.
Und das ist dann keine sich ins existenzielle Nirwana steigernde Poesie à la Kitano, sondern ein Märchen aus 1001 zuvorgekommenen Filmen, das allenfalls noch von der Ambivalenz seiner Hauptfigur unterwandert wird. Aber ist diese überhaupt tatsächlich präsent oder nur ein Ventil für eruptive Gewaltmomente? In denen wacht der Film ja am Meisten auf und hält selbst dann spekulativ drauf, wenn auch zum dritten Mal hintereinander der kleine Finger abgeschnitten wird. Solche Szenen sagen zwar aus, wie weit der Gaijin für seine Befreier gehen würde, aber es wird letztendlich nur im lustlosen Abhaken an Topoi draus geschlossen, wie dieses Verhältnis z.B. im Kontrast zum eigentlichen Nachkriegsverhältnis anno dazumal steht, eben was jene wechselseitige Anpassung macht oder ausmacht. Universelle Bruderschaft, gar die sehr altbackene Liebe zum exotischen Mädel? Irgendwo lungern profunde Werte, werden aber so oder so vom Film her aufs Mühseligste in drei Akten aufgelöst. Die Motivation des Narrativs gründet sich dann zwar noch immer auf der (spätestens seit Kurosawa/Leone erwiesenen) Faszination der westlichen Welt zum Themenkomplex Nippon und andersrum, verharrt aber in der Hemmung, schlicht von außen rein zu schauen und infolge dessen aus dem Innern in die Beliebigkeit zurück zu starren.
Und das ist dann keine sich ins existenzielle Nirwana steigernde Poesie à la Kitano, sondern ein Märchen aus 1001 zuvorgekommenen Filmen, das allenfalls noch von der Ambivalenz seiner Hauptfigur unterwandert wird. Aber ist diese überhaupt tatsächlich präsent oder nur ein Ventil für eruptive Gewaltmomente? In denen wacht der Film ja am Meisten auf und hält selbst dann spekulativ drauf, wenn auch zum dritten Mal hintereinander der kleine Finger abgeschnitten wird. Solche Szenen sagen zwar aus, wie weit der Gaijin für seine Befreier gehen würde, aber es wird letztendlich nur im lustlosen Abhaken an Topoi draus geschlossen, wie dieses Verhältnis z.B. im Kontrast zum eigentlichen Nachkriegsverhältnis anno dazumal steht, eben was jene wechselseitige Anpassung macht oder ausmacht. Universelle Bruderschaft, gar die sehr altbackene Liebe zum exotischen Mädel? Irgendwo lungern profunde Werte, werden aber so oder so vom Film her aufs Mühseligste in drei Akten aufgelöst. Die Motivation des Narrativs gründet sich dann zwar noch immer auf der (spätestens seit Kurosawa/Leone erwiesenen) Faszination der westlichen Welt zum Themenkomplex Nippon und andersrum, verharrt aber in der Hemmung, schlicht von außen rein zu schauen und infolge dessen aus dem Innern in die Beliebigkeit zurück zu starren.
Ein Stück weit mit
demselben problematischen Ansatz hadert auch das neue Romy-Schneider-Porträt „3 Tage in Quiberon“. Emily Atefs Berlinale-Beitrag
probiert anhand eines reduzierten Naturalismus, das Wesen der berüchtigten
Protagonistin binnen purer Intimität zu verinnerlichen. Zentral dafür gerät
eine Interview-Situation mit Vertretern des Stern
Magazins in eskalierende Gewissensangriffe über, welche ihr Subjekt mit
aller Gewalt zu fassen versuchen sowie mit voller journalistischer
Grenzüberschreitung auf Widerstände des Privaten einbohren (auch den Sekt aufstellen, obwohl Romy auf Entzug sein soll). Die Auflösung einer
Person des öffentlichen Lebens scheint keine Gefangenen zu machen, obgleich man
hauptsächlich Reaktionen denn wirklich konstruktive Reflexionen erwarten dürfte.
Seelen-Exhibitionismus halt. Mit der Realität müssen sich Film und Zuschauer (hoffe ich doch) zwangsläufig ebenso abfinden, also dass innerhalb solcher Rahmenbedingungen nichts
Absolutes an der Person Schneiders feststellbar sein wird. In der Umsetzung
aber beruft sich der Film offenbar auf eine immerwährende Melancholie
ihrerseits, eben eine, die sie mit ihrem Markenzeichen der hinterher hängenden Kindlichkeit zu
überspielen versucht. Ein bisschen Image, ein bisschen Anti-Image, fertig ist der Lack? Unter Umständen geht man mit so einer Charakteristik eher
noch in Sachen biographischer Einzelheiten in die Tiefe, wirklich vielschichtig
fällt der filmische Wert dessen auf dem Papier dann trotzdem nicht aus. Dass es
nicht so herbe ins Gewicht fällt, ist Marie Bäumer zu verdanken, die selbst aus
der noch so peniblen Mimikry des Interviews stets Echtes nach vorne fördert.
Das funzt auch daher so stimmig, weil der Film ihr nicht in die Quere kommt.
Der wirkt im Gegenzug seiner selbst willen oft zu diszipliniert-distanziert, von einer nie
aufgelösten Inkonsequenz und Irrelevanz unterlaufen. Gut, es basiert explizit
auf etwas Echtem und wenn man das vermitteln will, ist manch hingenommene Leere
sogar ein Muss. Trotzdem nutzt Atef auch abseits dieses Faktums kaum was an
filmtechnischen Möglichkeiten, auf etwas Inneres in jenen Etappen hinzuweisen,
außer Motive einer stinknormalen Kuranstalt – in Schwarz-Weiß immerhin!
Die Spannung kommt in jenem Szenario deutlich aus der zwischenmenschlichen Reibung, aber ihre Gestaltung, Kameraführung und Sounds bleiben konstant auf demselben Level von basic coverage. Es kann uns eigentlich kaum gleichgültig sein, was wir da sehen, aber genau mit dem Gefühl wird man angefüttert/hinausgezögert, was nicht mal mit dem Unterbau einer einnehmenden Atmosphäre ausgeglichen wird. Es ist dermaßen unpersönlich, aber die Unpersönlichkeit fließt so gut wie gar nicht ins Narrativ ein – dafür ist alles am Hotel und seiner Therapie zu gemütlich ins rechte Licht gerückt (Gegenbeispiel hierfür: „Die Sehnsucht der Veronika Voss“). In dem Sinne macht Quiberon seine 115 Minuten so schwer wie er dünn ist. Dennoch gibt es einzelne Situationen, die aus dem Nichts mit Haltung glänzen. Exemplarisch sei da die Kneipenszene genannt, in welcher die Euphorie der Trunkenheit auch inszenatorisch von einer Person zur nächsten schlendert, dort eine Möglichkeit des Seins aufbereitet, die der ansonsten übergreifenden Existenzverdrossenheit des Films etwas Paroli bietet. Genauso gut dürften die Anflüge zarter Freundschaft innerhalb des Quartetts um Schneider, Freundin Hilde Fritsch (Birgit Minichmayr) und Journalisten (Robert Gwisdek und Charly Hübner) greifen, wenn sie denn nicht ständig von der Sorge bzw. der Ausbeutung der Sorge überschattet wären. Im Dialog stellt der Film diesen Umstand sogar an sich selber fest – es fällt ihm aber nur für wenige Momente ein, aus jener Monotonie wirklich auszubrechen, z.B. wenn der Kellner mit Hilde flirtet oder wenn der Film in kurzen Stichpunkten auf die Brüchigkeit derer kommt, die nicht Romy Schneider heißen. Und dankenswerter Weise schließt Atef auch mit einer Note des Aufschwungs, der Ablösung vom Zwang des per Öffentlichkeit verprellten Ichs. Doch mit solch einer dem Zuschauer gereichten Methodik bleibt der Film halt nochmals absolut vage. Kann ich auch jetzt noch nicht beurteilen, ob’s in dem Fall positiv oder negativ nachwirkt.
Die Spannung kommt in jenem Szenario deutlich aus der zwischenmenschlichen Reibung, aber ihre Gestaltung, Kameraführung und Sounds bleiben konstant auf demselben Level von basic coverage. Es kann uns eigentlich kaum gleichgültig sein, was wir da sehen, aber genau mit dem Gefühl wird man angefüttert/hinausgezögert, was nicht mal mit dem Unterbau einer einnehmenden Atmosphäre ausgeglichen wird. Es ist dermaßen unpersönlich, aber die Unpersönlichkeit fließt so gut wie gar nicht ins Narrativ ein – dafür ist alles am Hotel und seiner Therapie zu gemütlich ins rechte Licht gerückt (Gegenbeispiel hierfür: „Die Sehnsucht der Veronika Voss“). In dem Sinne macht Quiberon seine 115 Minuten so schwer wie er dünn ist. Dennoch gibt es einzelne Situationen, die aus dem Nichts mit Haltung glänzen. Exemplarisch sei da die Kneipenszene genannt, in welcher die Euphorie der Trunkenheit auch inszenatorisch von einer Person zur nächsten schlendert, dort eine Möglichkeit des Seins aufbereitet, die der ansonsten übergreifenden Existenzverdrossenheit des Films etwas Paroli bietet. Genauso gut dürften die Anflüge zarter Freundschaft innerhalb des Quartetts um Schneider, Freundin Hilde Fritsch (Birgit Minichmayr) und Journalisten (Robert Gwisdek und Charly Hübner) greifen, wenn sie denn nicht ständig von der Sorge bzw. der Ausbeutung der Sorge überschattet wären. Im Dialog stellt der Film diesen Umstand sogar an sich selber fest – es fällt ihm aber nur für wenige Momente ein, aus jener Monotonie wirklich auszubrechen, z.B. wenn der Kellner mit Hilde flirtet oder wenn der Film in kurzen Stichpunkten auf die Brüchigkeit derer kommt, die nicht Romy Schneider heißen. Und dankenswerter Weise schließt Atef auch mit einer Note des Aufschwungs, der Ablösung vom Zwang des per Öffentlichkeit verprellten Ichs. Doch mit solch einer dem Zuschauer gereichten Methodik bleibt der Film halt nochmals absolut vage. Kann ich auch jetzt noch nicht beurteilen, ob’s in dem Fall positiv oder negativ nachwirkt.
Ausgesprochen positiv eingestellt war ich in letzter Zeit allerdings gegenüber Jim Sheridans „Get Rich or Die Tryin‘“, obgleich der
Film in seiner verfremdeten Selbstdarstellung des 50 Cent Curtis Jackson weit vereinfachter auf Biographisches
blickt, in eine trivial verdauliche Gut-gegen-Böse-Chronologie vom Street Life bettet. Die Glorifizierung
des Gangsta-Raps ist dementsprechend von vielerlei Grauzonen getilgt oder an
den heikelsten Stellen so überspitzt ins Positive gepolt worden, wie es inzwischen
nur noch voll Fragwürdigkeit amüsieren kann. Drehbuchautor Terence Winter ließ
später auch den „Wolf
of Wall Street“ in seiner Selbstherrlichkeit auflaufen, hier vermengt er seinen Mangel an kritischer Distanz aber noch mit höchst spekulativer Milieu-Zeichnung – und das obwohl die
Beteiligten alle Möglichkeiten hätten, sich aus ihrem jeweils aufgepeitschten
Klischee herauszulösen. Umso kurzweiliger kommt das Biopic-Prozedere sofort auf
Intensivstation, den Mythos des kugelsicheren Multitalents im high drama totalen Ghetto-Kintopps
auszustaffieren – wo die Kindheit um die Hooker-with-a-heart-of-gold
von Mutter kreist, später per Mentor ins Drogen- wie Hip-Hop-Geschäft
einsteigt, um letztendlich sich selbst, den echten Daddy/Muttermörder sowie
eine glückliche Vervollständigung mit Frau und Kind zu finden. Würde man noch
klassische Musik druntermischen, müsste „Moonlight“
hier einen ernsthaften Konkurrenten fürchten – und damit ist nicht nur vom
thematischen Gehalt her die letztendlich rahmenbildende Bromance zu Terrence
Howard oder die Hassliebe von/zu Drogen-Kingpin Majestic (Adewale
Akinnuoye-Agbaje) gemeint. Klar, ist jetzt ein überkandidelter Vergleich, aber
zumindest im Sog machen sich beide Filme ebenbürtig um Aufmerksamkeit verdient.
Der eine lässt halt seine Charakterstudie in Bildern nachfühlen, der andere in
ultravulgärem Cliquen-Slang auf der road
to success.
Und dann kommen noch durchweg kindliche Anwandlungen des Protzens zur Geltung, die selbst per Mietwagen auf dicke Hose machen – dann nennen ihn nämlich alle im Viertel „den Hübschen“, zu drollig! Auch irgendwie kindlich geht der Film mit einem um, wie plötzlich Handlungselemente und Figuren eingeführt werden, die im Ensemble als selbstverständlich gelten, gar auf einmal weitreichenden Einfluss von Kindesbeinen an haben – obwohl die zu dem Zeitpunkt im Film kaum anwesend waren, trotzdem großen Aufwind produzieren. Man bemerke dafür allein die Wiederbegegnung unseres Marcus (50 Cent) mit seiner angeblichen Jugendliebe Charlene (Joy Bryant) und wie weit das ab dort entwickelt wird/zurück gehen soll. Es wird nicht der einzige wundersame Irritationspunkt des Films bleiben. Falls man davon mal nicht kurios am Halse gepackt wird, stehen die Dialoge Schlange, einen mit drübberen Proklamationen und inspirierenden wie bedrohenden Phrasen auf die schiefe Bahn zu führen. Die ganze Aufregung ist so sympathisch aufs Epische im Profanen aus und innerhalb seiner ballernden Missetaten zudem energisch mit Erklärungs-/Deeskalationsversuchen gewappnet, dass man kaum glaubt, welch Krönung noch auf einen wartet: Die Messerstecherei in der Gefängnisdusche! Die geht auf die Barrikaden wie eine Mischung aus „Eastern Promises“ und „Zwist in Zellenblock 99“, wie eruptiv da mit Klingen, Seife, Schwänzen und Polizeiknüppeln um Gerechtigkeit und Aufstand gehadert wird, ehe eine neue Brüderlichkeit entsteht. Hätte sich das Intro von „The Outsider“ mal mehr hiervon abgeguckt! Man sieht: Es gibt viele einzelne Faktoren/Sequenzen/Eigenarten, die den Film hier mächtig gewaltig pimpen, obgleich er in Sachen Feingefühl erwartungsgemäß stets in der Klemme steckt – wartet mal ab, wie Oscar-verdächtig es sodann rüberkommt, wenn 50 Cent mit zugenähtem Mund in Beziehungsprobleme der Kommunikation abgleitet: Wie der ganze Film ein problematischer Mordsspaß in Formvollendung!
Und dann kommen noch durchweg kindliche Anwandlungen des Protzens zur Geltung, die selbst per Mietwagen auf dicke Hose machen – dann nennen ihn nämlich alle im Viertel „den Hübschen“, zu drollig! Auch irgendwie kindlich geht der Film mit einem um, wie plötzlich Handlungselemente und Figuren eingeführt werden, die im Ensemble als selbstverständlich gelten, gar auf einmal weitreichenden Einfluss von Kindesbeinen an haben – obwohl die zu dem Zeitpunkt im Film kaum anwesend waren, trotzdem großen Aufwind produzieren. Man bemerke dafür allein die Wiederbegegnung unseres Marcus (50 Cent) mit seiner angeblichen Jugendliebe Charlene (Joy Bryant) und wie weit das ab dort entwickelt wird/zurück gehen soll. Es wird nicht der einzige wundersame Irritationspunkt des Films bleiben. Falls man davon mal nicht kurios am Halse gepackt wird, stehen die Dialoge Schlange, einen mit drübberen Proklamationen und inspirierenden wie bedrohenden Phrasen auf die schiefe Bahn zu führen. Die ganze Aufregung ist so sympathisch aufs Epische im Profanen aus und innerhalb seiner ballernden Missetaten zudem energisch mit Erklärungs-/Deeskalationsversuchen gewappnet, dass man kaum glaubt, welch Krönung noch auf einen wartet: Die Messerstecherei in der Gefängnisdusche! Die geht auf die Barrikaden wie eine Mischung aus „Eastern Promises“ und „Zwist in Zellenblock 99“, wie eruptiv da mit Klingen, Seife, Schwänzen und Polizeiknüppeln um Gerechtigkeit und Aufstand gehadert wird, ehe eine neue Brüderlichkeit entsteht. Hätte sich das Intro von „The Outsider“ mal mehr hiervon abgeguckt! Man sieht: Es gibt viele einzelne Faktoren/Sequenzen/Eigenarten, die den Film hier mächtig gewaltig pimpen, obgleich er in Sachen Feingefühl erwartungsgemäß stets in der Klemme steckt – wartet mal ab, wie Oscar-verdächtig es sodann rüberkommt, wenn 50 Cent mit zugenähtem Mund in Beziehungsprobleme der Kommunikation abgleitet: Wie der ganze Film ein problematischer Mordsspaß in Formvollendung!
Eine gute
Überleitung übrigens zu meinem nächsten Trio - gewiss wieder eins, das (passend zu den anderen Beispielen dieser Ausgabe) mit der
medialen Interpretation von Tätern und Opfern jeweils sehr wählerisch Spannung
per Provokation erzeugt. Und zwar handelt es sich um drei Verfilmungen der
Causa Gladbeck. Innerhalb der letzten Wochen dürfte der hiesigen Allgemeinheit
wieder des Öfteren in Erinnerung gerufen worden sein, was im August 1988 binnen
der BRD geschah. Ich will daher nicht nochmal wiederholen, wie das tödliche
Geiseldrama des Trios Rösner/Degowski/Löblich verlaufen ist oder wie ich die
Handlungen von Polizei und Presse werten würde. Für jede Position zu diesem
Sachverhalt gibt es nämlich schon mindestens einen Spiel- bzw. Dokumentarfilm und um in dem Sinne mal einen Überblick zu geben, beäuge ich drei Vertreter,
die allesamt aus ihren individuellen Gründen auch kein vollends differenziertes Bild dessen liefern können: Zum
einen wäre da das eher schwache Drama „Ein
großes Ding“ von Bernd Schadewald. Der Regisseur hatte sich mir mit Filmen
wie „Angst“ (1994) als
Blickverstärker der geläufigen Sozialstudie gezeigt, indem er besondere
Härtefälle menschlicher Untiefen entsprechend schroff im Naturalismus anordnen
konnte (siehe auch den etwas gemäßigteren, aber stilverwandten Uwe Frießner).
Sehr grell, aber auch sehr nah. Dasselbe wollte ich mir von seiner losen
Adaption der Gladbeck-Chronologie erhoffen, doch allein die Besetzung von Richy
Müller, Jürgen Vogel, Uwe Fellensiek und Katja Flint ist schlicht zu viel des
Guten. Ab und an wurde ja argumentiert, dass der Cast zur Parodie neigen will, doch wenn man als Maßstab ohne Weiteres Christoph Schlingensiefs „Terror 2000“
nehmen kann, wirkt es umso befremdlicher, wie die realen Ereignisse hier gleichsam
für einen echten Zweiteiler-Krimi Pate stehen und in den Abänderungen auf
plumpe Kolportage angesetzt werden. Die Trivialisierung nimmt Überhand, nur im
Vergleich zum 50-Cent-Film entsteht da lediglich bedingt ein Unterhaltungswert
– zumal Müller und Vogel permanent am Schreien sind; Verfolgungsjagden, Fluchtsituationen
sowie die Rollen von Medien und Polizei ohnehin auf eindeutiges TV-Niveau hin
aufbereitet sind. Interessant am Film ist aber, wie er einem die Gangster sogar
noch sympathisch zu machen versucht – eben als rotzige Typen, die eigentlich
ganz nett sein wollen/könnten, ihren Nichten Gute-Nacht-Geschichten erzählen und sich schlicht ein besseres Leben wünschen,
wenn man sie nicht vorsorglich-lebenslänglich in die soziale Endstation verfrachtet hätte.
Solche Argumente präsentiert in etwa auch der Dokumentarfilm „Der Geiselgangster von Gladbeck“ von
Uta Claus. In diesem recht frühen Portrait von 1991 wird speziell der Lebensweg
Dieter Degowskis durch Zeitgenossen nacherzählt und interpretiert. Ehemalige
Nachbarn, Kollegen, eines seiner Geschwister, ehemalige Geiseln sowie
Psychologen und sogar sein Strafverteidiger kommen zu Wort. In den Gesprächen
wird eine grausame Kindheit offenbart, folglich auch in welchen Bedingungen
kaum Hoffnung für den Mann keimen konnte und in welchen Kreisen er sich also
fortwährend noch was wert fühlte. Alles Aussagen, die in konkreter Abbildung
zwar nicht werten, in der Ballung aber natürlich Partei ergreifen müssten.
Dagegen stehen ausgerechnet die Aussagen, die in Richtung Sympathie gehen, da
sie allesamt von einer gewissen Naivität herrühren – Schwester und Kumpel
meinen, dass er mit ihnen mitgekommen wäre, wenn sie frühzeitig dagewesen und
die Polizei sie nur gemacht lassen hätten;
Strafverteidiger und Psychologen lassen zudem jeden verhängnisvollen Impuls als
Reaktion auf die Vergangenheit oder auch jede Behauptung der Reue als Anlass
zur Schuldverminderung gelten, selbst wenn sie noch so bizarr klingen mögen
(u.a. Degowskis Anruf ans Totenreich, dass Silke Bischoff ihm auf dem Wege
schon verziehen, er Emanuele De Giorgi aber noch nicht erreicht hätte). Was
seine überlebenden Opfer zu ihrer Begegnung mit ihm zu sagen haben, scheint
zudem hauptsächlich von Unberechenbarkeit gezeichnet zu sein, eben wie wenig
sie alles abseits der permanenten Furcht beurteilen konnten. Der Film hat also
ein ziemlich offenes Auge für Mängel und Zwiespälte in der Menschenkenntnis
seiner Zeit, als dass er händeringend um ein Urteil zur Person Degowskis
argumentieren würde. In der Funktion vermeidet es der Film aber eher, die Rolle
der Medien als Faktor in dem Fall kritisch zu betrachten – dann würde er sich
ja selbst als erneute Projektionsfläche dessen reflektieren müssen, aber ohne
diesen Aspekt wird die Sache wiederum heikler, insbesondere da einige
Zwischentitel mit enorm finsterer Musik darauf hinweisen, welche
Interviewpartner man aufgrund der Entscheidungen der Justiz nicht aufsuchen
durfte. In eine ähnliche Falle tappte übrigens auch die Docu-Fiction RTL’s zu
dem Fall, „Wettlauf mit dem Tod“
(1998), als diese die Mittäterin Marion Löblich selbst vor die Kamera zum
Interview ranholte. Dort durfte sie sich dann im Nachhinein über die Aktionen
von Polizei und Presse empören, auch dass man sie selbst hätte schneller
schnappen müssen, bis sie in den nachgestellten Szenen zeitweise sogar zur
Stimme der Vernunft hochstilisiert wurde. Wenn noch Brisanteres an
Distanzlosigkeit in dem Film aufgetaucht wäre, würde ich jetzt auspacken, aber
ich belasse es lieber dabei, noch zu erwähnen, dass
Rudolf-Thome-Stammschauspieler Cornelius Schwalm hier eine seiner ersten Rollen
als Rössner inne hatte!
Zum Schluss sei aber noch die aktuellste Adaption des
Falls genannt, schlicht „Gladbeck“ -
knapp rechtzeitig zum 30. Jubiläum der damaligen Ereignisse von Kilian Riedhof
inszeniert und von der ARD als Zweiteiler zur Primetime ausgestrahlt. Die
Beweggründe dafür sind mir im Nachhinein weiterhin etwas schleierhaft. Rein
oberflächlich betrachtet gibt dieses Event
einen ziemlich straffen Terrorfilm
ab, der allerdings auch ausschließlich dieses Gefühl auszudrücken imstande ist.
Jedes Mal, wenn er die Zwischentöne der einst tatsächlichen Reaktionen
nachzuzeichnen versucht, wirkt er daher komplett neben der Spur und
widersprüchlich binnen seiner selbst. Der inszenatorische Grundmodus der
Bedrohung gibt zwar permanent Druck in (merkwürdig coloriertem) Cinemascope und Synth-Drones, doch da beißen sich erst recht die naturalistischen
Eindrücke der Mimikry mit hochdramatisierten Drehbuchphrasen anhand von
Einsatzleitern. Zudem sieht man sich als Zuschauer auch auf eine
Emotionalisierung angesetzt, die dem Desasterfilm-Prinzip gemäß einzelne
Vorgeschichten, Betroffenheits-Sequenzen und Gesten des Gefühls als Symbolbilder
der Menschlichkeit spekuliert. Ist
jetzt halt ein Film-Film, von daher sind Rössner und Co. vollends als fettige
und räudige Monster ohne echten Kontext ihrer Präsenz gezeichnet. Da steckt man
gar nicht mal uneffektiv und vor allem intensiver in der Sommerhitze der Angst
drin, zumal sich der Thrill modern körperbetont zwischen Neonlicht und
Bordstein reindrückt - doch es ist wie gesagt die einzige Stärke dieser Odyssee.
Das größte revisionistische Potenzial hätte ich eigentlich in der Darstellung von
P+P vermutet und da ist die Sache für wahr ziemlich kurios ausgefallen:
Einerseits wollte Riedhof den Schock der stets vermasselten Annäherung an die
Täter für den Effekt ausnutzen, andererseits den einzelnen Urhebern mehr oder
weniger stets gerecht werden. Fast immer ist es ein Gewissenskonflikt, eine
ethische Brenzligkeit, Zivilcourage, Überzeugung aus Angst oder eben eine Frustration,
die gegen die eigene Überzeugung stimmen muss. Tendenziell entscheidet der Film
in der Menge an Konflikten eher zugunsten der Polizei, à la „Die Gesetze sind zu lasch, es mangelt an
Führung in solchen Fällen.“. Gibt man dem besorgten Bürger damit nicht Grund zur Sorge, dass die Polizei auch
angeblich heute noch nicht das Rechte tun
darf? Und dann auch noch gegenüber einer Presse, die das Spektakel frech und falsch für sich einnimmt? Nun,
der Film ist in Wirklichkeit dann doch nicht fähig, irgendwas in der Sache aufzuwiegeln. Bei ihm verschwimmen die
Ereignisse im Trauma der Machtlosigkeit und haben bei der Deeskalation des Individuums schlicht keine Zeit für Empörung. Unterschieden
wird hauptsächlich zwischen Opfern, Tätern und denjenigen, die das Ganze
beenden wollten. Dass es an jeder Stelle hunderte an Schaulustigen gab, will man
dem Zuschauer daher auch eher verheimlichen, sonst müsste er den moralischen
Diskurs der Handlungsunfähigkeit eventuell ja mit sich selber anstelle derer
innerhalb dargestellter Machtpositionen führen. Puh, ein schwieriges
Themengebiet, ganz bescheiden gesagt!
Ich weiß jetzt gar nicht mal so recht,
wie’s euch als Leser geht. Hmm, habt ihr denn in dieser Ausgabe an Tipps
genügend Tipps erhalten? Ich weiß,
diesmal ist wieder so eine Reihe zustande gekommen, in der ich eher die
thematische Connection der Filme untereinander ausschreiben wollte. Dabei hab
ich erstmals dank feiner Ausleihe vonseiten Siggi Bendix' einige teils grandiose Selbstläufer gesehen, wie z.B. „The Purple Rose of Cairo“, „Zwei Tage, eine Nacht“, „Ein Amerikaner in Paris“, „A.I. – Künstliche Intelligenz“ und vor
allem „Vertigo – Aus dem Reich der Toten“!
Herrje, was für eine Auswahl – aber die Sache ist ja die: Ihr kennt sie schon und
ich habe mich vor lauter Ehrfurcht erstmal zurückgehalten, Deutungen und
Meinungen zu schreiben, die bei solchen Werken bestimmt schon zu Genüge ausklamüsert
wurden. Tja… aber einen habe ich gesehen, der ist vielleicht nicht ganz so
weitläufig im Kanon verewigt – und zwar Klaus Lemkes schöner kurzer „Mein schönes kurzes Leben“ von 1970. Der
ist schmissig, elliptisch, vollkommen im Hier und Jetzt seines Problemfalls
Mischa (Michael Schwankhart) auf geistiger Achterbahnfahrt, todtrist binnen der
BRD-Großstadtmoloch-Monochromatik gejagt und doch höchst romantisch, keck und im
Faustrecht, drogenschmuggelnd/-klauend und mit der Vergänglichkeit flirtend, in
Wohnungen gammelnd oder an der Würstchenbude aufgedreht, total salopp nachsynchronisiert
oder zaghaft mit der Sprache der Augen rausrückend, Musikvideo und urbanes Winter-Fegefeuer,
im Spiegelspaß des Konsums wiederbegegnend, auf Erfolgskurs in der
Plattenbranche gen Hamburg pendelnd und doch mit der Eifersucht auf der Flucht,
überall von rabiaten Bullen und Gangstern gesucht und dennoch an der frischen
Luft labend, ein Bonvivant der Anarchie und garantiert sterbendes Systemopfer
zugleich. Was für ein himmlischer Ritt. Nach dem Film war’s dann nur noch halb
so schlimm, dass ich am selben Abend im Folgenden die Oscars sehen musste. Aber
wir kommen vom Thema ab - man liest sich beim nächsten Mal, danke!